Dann war es soweit. Am 22. Juni 1941 brach der deutsch-sowjetische Krieg aus. In einem riesigen Bogen von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer waren die deutschen und sowjetrussischen Verbände aufmarschiert. Während uns gegenüber die 11. deutsche Armee unter Generaloberst Ritter von Schoben zusammen mit den Verbänden der rumänischen 3. und 4. Armee hinter dem Pruth in Bereitstellung ging, standen auf seiten der Roten Armee unter Marschall Budjenny zwischen Czernowitz und den Pripjetsümpfen etwa 56 Kampfverbände, darunter drei Panzerdivisionen und sieben motorisierte Mech-Brigaden. Und wir lagen mitten drin.
Der Krieg meldete sich auch in Czernowitz zuerst mit Bomben zu Wort. Deutsch-rumänische Maschinen bombardierten das Roscher Gebiet, weil dort sowjetische Panzer konzentriert waren. In den sauberen, netten Häuschen hatten sich die sowjetischen Offiziere breitgemacht.
Schon in aller Frühe füllte sich am Sonntag das Stadtzentrum mit der erschrockenen Bevölkerung. Es erinnerte mich alles qualvoll an Lemberg.
Was sollten wir tun? Wir konnten nichts unternehmen, nur den Kopf einziehen und hoffen, daß uns keine Bombe und keine Granate auf den Kopf fallen würde. Vor einem Jahr hatte uns die Rote Armee von den Rumänen befreit. Jetzt schickten sich die Deutschen und die Rumänen an, uns von den Sowjetrussen zu befreien. Es war ein bißchen zuviel Befreiung in so kurzer Zeit.
Nach diesem ersten Bombardement blieb es jedoch zu unserem allgemeinen Erstaunen vorerst noch ruhig. Während die deutschen Divisionen schon tief in Galizien eingedrungen waren, schien bei uns der Krieg noch zu schlafen. Dann zeichnete sich auf der Landkarte das geradezu geniale deutsche Konzept ab. Völlig kampflos mußten am 1. oder 2. Juli die starken sowjetischen Streitkräfte die Bukowina räumen, um nicht eingekesselt zu werden. Kurz vorher wurden die sowjetischen Zivilisten evakuiert, und wieder entstand eine große Unruhe in der Stadt. Ein kleiner Teil der Bevölkerung folgte den Sowjets, die anderen blieben an Ort und Stelle. Sie fühlten sich in ihrer Heimat noch am sichersten.
Ein paar Tage lang lag Czernowitz buchstäblich im Niemandsland. Die Gerüchte überschlugen sich. Keiner wußte wirklich, was los war. Flüchtlinge, die in die Stadt strömten, erzählten viel, aber meist sagte der eine genau das Gegenteil von dem, was der andere berichtete. Zeitungen erschienen nicht mehr. Die Redakteure waren längst mit der Roten Armee abgerückt. Rundfunkapparate waren nicht vorhanden, da sie der örtliche Sowjet bei Ausbruch des Krieges abgeholt und im ehemaligen Börsengebäude in der Postgasse gelagert hatte. Sie waren teils verschwunden, teils vernichtet.
Wenn wir nicht in der Ferne das Rollen der Schlachten vernommen hätten und wenn sich nicht die widersprechendsten Gerüchte geradezu überschlagen hätten, wären wir verführt gewesen zu glauben, daß man Czernowitz vergessen habe.
Plötzlich aber erfuhren wir entsetzliche Dinge, die sich in unserer nächsten Nähe ereignet hatten. Aus Kuty kommend, waren nationalistische ukrainische Banden in die Bukowina sengend und brennend eingedrungen. Überall überfielen sie die wehrlose jüdische Bevölkerung und schlachteten sie ab. Besonders in Radauti und Gzudin fielen ihnen beinahe alle Juden – es waren Tausende – zum Opfer.
Eine andere Bande marschierte aus Snatyn bis gegen Czernowitz vor, wagte aber nicht, die Stadt zu überfallen, da sie sich nicht stark genug fühlte. Im Städtchen Boijan mordeten die Ukrainer Hunderte von Juden; selbst die ortsansässigen Ukrainer, die sich den Banditen entgegenstellten, wurden niedergemacht. Erst die deutschen und rumänischen Truppen, die am 5. Juli 1941 in Czernowitz einmarschierten, machten diesem Treiben ein Ende. Sie verjagten die Ukrainer und stellten die Ruhe wieder her. Die Toten allerdings wurden dadurch nicht mehr lebendig.
Ein Widerstand gegen die Deutschen und Rumänen war nirgends vorhanden. Die Besetzung der ganzen Bukowina vollzog sich nahezu kampflos. Wir atmeten vorerst einmal auf.
Jedoch schon am zweiten Tage wurden in der Stadt Czernowitz Plakate angeklebt, durch welche die arbeitsfähigen Männer jüdischer Nationalität aufgefordert wurden, sich in der großen Schule in der Schulgasse zu melden. In Windeseile wurde bekannt, daß eine kleine Anzahl Juden, unter ihnen der Stadtrabbiner, vorher festgenommen worden war. Sie mußten im Hause der Kultur, einem der schönsten Gebäude der Stadt, das unter rumänischer Herrschaft errichtet worden war, Aufräumungsarbeiten leisten. Die Rotarmisten hatten ein unvorstellbares Durcheinander zurückgelassen. Nach getaner Arbeit wurden die Facharbeiter von den Nichtfacharbeitern abgesondert. Die letzteren wurden im Keller des Gebäudes bald darauf kurzerhand erschossen.
Gleichzeitig wurde in den vornehmeren Stadtteilen wohnenden Juden befohlen, in das jüdische Armenviertel zu übersiedeln. Jeder durfte aus seiner Wohnung mitnehmen, was er tragen konnte. So entstand das Getto von Czernowitz, ein von Menschen überfülltes Gebiet, in dessen wenigen Gassen es bald wie auf einem Ameisenhaufen wimmelte. Wo einst zwei oder drei Personen in einem Raum hausten, drängten sich nun zehn oder mehr Menschen.
Demgegenüber hatten es die ausgesonderten Facharbeiter beträchtlich besser. Ein kleiner Teil von ihnen erhielt sogar die eigene Wohnung zurück, auch die anderen durften sich frei in der Stadt bewegen. Dennoch gab es zwei Möglichkeiten, dem Getto zu entgehen. Man nahm, so man hatte, frühere berufliche oder gesellschaftliche Verbindung mit den nunmehr zurückgekehrten Rumänen auf. Diese halfen oftmals ihren früheren Geschäftspartnern. Andere ließen sich nach griechisch-orthodoxem Ritus taufen. Ein griechisch-orthodoxer Pfarrer, der ebenfalls mit den Truppen in die Stadt zurückgekehrt war, nahm bereitwillig diese Taufakte vor und half dadurch vielen Juden aus dem Getto. Nicht alle Juden waren indes bereit, dem Glauben ihrer Väter untreu zu werden.
In kürzester Zeit wurde die neue Zivilverwaltung der Stadt organisiert. Bürgermeister wurde der Rumäne Popovic. Er gab sogleich 15000 Juden die Erlaubnis, in der Stadt zu bleiben, und sie konnten auch die teilweise schon geräumten Wohnungen wieder in Besitz nehmen.
Trotz der erdrückenden Verhältnisse begann sich das Leben im Getto nach einigen Wochen einigermaßen zu normalisieren. Mit einemmal kam das Gerücht auf, daß das Getto aufgelöst werden würde und wir alle in das deutsch-rumänisch besetzte Dnjestrgebiet verschickt würden.
Ich hatte mich vor dem Arbeitseinsatz kurzerhand gedrückt. Obgleich ich Facharbeiter war, riskierte ich etwas und versteckte mich in der Morariogasse bei Bekannten. Da wir nicht im reichen Viertel der Stadt wohnten, befanden wir uns schließlich aber doch mitten im Getto.
Uns Bukowiner Juden entstand in diesen Tagen ein großer und echter Freund in der Person des Metropoliten der orthodoxen Kirche, Samandrea. Er taufte nicht nur wahllos Juden, sondern setzte sich auch immer wieder beim rumänischen Ministerpräsidenten Mihai Antonescu für die Juden ein und informierte sogar den sephardischen Oberrabbiner Rumäniens, Salfran, laufend über unsere Lage. Der Metropolit konnte sich natürlich im ganzen Lande frei bewegen. Dabei war Samandrea ein enger persönlicher Freund des berühmten antisemitischen Vorkämpfers Rumäniens, Professor Cuza. Die Juden der Bukowina verdanken dem Metropoliten unsagbar viel. Auch der Patriarch der orthodoxen Kirche in Rumanien, Nicodemus, half den Juden, wo er nur konnte.
Aus Lemberg erfuhren wir später, daß sich dort ähnliches zugetragen hatte. Kurz nachdem 1941 in Galizien die Judenverfolgung einsetzte, bat der Oberrabbiner Dr. Levin von Lemberg den Metropoliten Scheptizki um Hilfe. Der Metropolit, ein früherer polnischer Adeliger, der sein Volk und seine Religion verlassen hatte, um sich ganz dem orthodoxen Glauben und dem ukrainischen Volke zu widmen, hörte ungläubig zu und beruhigte Dr. Levin; er konnte an eine drohende Gefahr für die Juden nicht glauben.
Kurze Zeit später war der Oberrabbiner unter den ersten, die von den Ukrainern erschossen wurden. Metropolit Scheptizki war entsetzt. Er machte sich heftige Vorwürfe, daß er dem Oberrabbiner seine aktive Hilfe verweigert hatte, versammelte die Mönche des Klosters "Heiliger Jars" und trug ihnen den Plan, den er nun gefaßt hatte, vor. Er wollte die meistbedrohten Juden von Lemberg in Mönchskutten kleiden und im Kloster verstecken. Jedoch überließ er die Entscheidung seinen Mönchen, da dieses Unterfangen sehr gefährlich war. Die Mönche beschlossen einstimmig, gemeinsam die Verantwortung zu übernehmen, auch wenn es ihr Leben kosten sollte. Daraufhin nahm der Metropolit Scheptizki etwa 180 Juden in das Kloster "Heiliger Jars" auf, unter ihnen die beiden Söhne des Oberrabbiners Dr. Levin und den Rabbiner von Kattowitz. Den ganzen Krieg über wurden diese Juden verpflegt und beschäftigt und so gerettet.
Und dies waren keine Juden, die ihr Leben für die Rettung jüdischer Mitbürger einsetzten. Jetzt, in der brutalen Gefahr, erkannte man erst, wie unsinnig alle Theorie war. Letztlich entschied der Mensch, nicht eine politische Auffassung, ja nicht einmal eine Religion oder die Zugehörigkeit zu einem Volk oder einer Rasse.
Im Czernowitzer Getto fühlten wir uns einigermaßen sicher. Darum erschreckten uns die Gerüchte von der bevorstehenden Auflösung sehr. Aus Bessarabien hörten wir nur furchtbare Dinge. Dort sollten ganze jüdisch bewohnte Orte völlig ausgelöscht und die gesamte Bevölkerung erschossen worden sein. Aber alle Furcht half uns nichts. Eines Morgens wurden wir alle mit Gewalt aus dem Getto vertrieben und in Viehwagen auf dem Güterbahnhof im Volksgarten verladen. Durch Zufall hatte ich erfahren, daß es diesmal Ernst würde. Da ich erkannte, daß es einen Ausweg nicht mehr gab, organisierte ich soviel Verpflegung, wie nur möglich war, und wir gingen, schon bevor zum Transport aufgerufen wurde, zum Güterbahnhof. Wer früher kam, war weit besser daran als jene, die sich zum Schluß herantreiben ließen. So kam es, daß wir, die wir rechtzeitig zum Volksgarten gingen, zu dreißig bis vierzig im Viehwaggon Platz fanden, während die Unglücklichen, die später kamen, zu neunzig bis hundertzwanzig hineingepfercht wurden. Die rumänischen Soldaten, die uns bewachten, kümmerten sich weiter nicht um uns. Sie erfüllten lediglich ihren Befehl. Verpflegung bekamen wir keine. Dann wurden die Waggons von außen verschlossen, und wir fuhren ab, genauso wie vor einigen Monaten viele von uns in Richtung Sibirien gefahren waren. Wir fuhren und fuhren.
Die Zustände in den Viehwaggons waren bald unbeschreiblich. Mühsam konnten wir Löcher in die Wände bohren, es gab keine Kloanlagen und keine Hilfe, wenn jemand erkrankte. So geschah es, daß Tote und Lebende nebeneinander lagen. Und so ging es zwei Wochen lang. Manchmal hatten wir das Gefühl, daß der Transport sich im Kreise bewegte. Endlich langten wir in Mogilew an. Wir waren völlig apathisch, als wir schließlich an der Haltestelle Atachi anhielten.
Zuerst hatten wir angenommen, daß diese Verschickung eine Strafe für jene Juden darstelle, die sich der sowjetischen Herrschaft gebeugt hatten. Kaum taumelten wir aus unseren fahrenden Gefängnissen ins Freie, wurden wir eines Besseren belehrt. Wir trafen dort nämlich auch viele Juden, die aus dem nicht sowjetisch besetzt gewesenen Teil der Bukowina sowie aus anderen Teilen Rumäniens stammten. Der rumänische Ministerpräsident Antonescu dachte nicht daran, alle Juden seines Landes ans Messer zu liefern. Jedoch um den zahlreichen rumänischen Antisemiten der Eisernen Garde und den deutschen Verbündeten gewisse Konzessionen zu machen, opferte er einen Teil der Juden aus den Randgebieten Rumäniens. Hier in Transnistrien entstand mit dem Zentrum Mogilew ein riesiges Anhaltelager für die Juden aus Bessarabien, der Bukowina und einigen Randgemeinden, zum Beispiel Dorohoi, Suceava, Itcani und anderen. Alles in allem waren hier 200 000-250 000 Juden versammelt.
Die Rumänen hatten wohl über das ganze Gebiet das Oberkommndo, wovon wir aber leben sollten und wie wir leben sollten, darum bekümmerten sie sich praktisch überhaupt nicht. Es gab zur Organisierung der kümmerlichen Lebensmöglichkeiten eine Art jüdischer Selbstverwaltung, den Judenrat, dem sogar eine jüdische Polizei zur Seite stand.
Noch ganz benommen von dieser schrecklichen Anreise, erfaßten wir zuerst die Umstände gar nicht. Schließlich wurde uns in einem Fabrikraum bekanntgegeben, daß der Transport auf verschiedene Orte aufgeteilt würde. Eine Gruppe von etwa dreißig Personen wurde für das Städtchen Bershad bestimmt.
Isidor, der mit seiner Schwester beisammen war, kam von einer nahen Schule, in der andere Gruppen des Transportes untergebracht worden waren, herüber, um sich zu verabschieden. Er war zu einem anderen Transport eingeteilt worden. Wir wußten damals nicht, daß es ein Abschied fürs Leben war. Isidor ging an der bald eintretenden Typhusepidemie zugrunde.
Unser Bershad-Transport brach kurz danach im Fußmarsch auf, um unseren etwa achtzig Kilometer entfernten Bestimmungsort zu erreichen. Wir brauchten etwa zweieinhalb Tage, bis wir das kleine Bershad erreichten, wo uns ein Vertreter des jüdischen Komitees zunächst in ein verlassenes Kolchoshaus einwies, bis wir endlich Unterkunft in einem der vielen leerstehenden Häuser erhielten, in denen bis vor kurzem Bauern gewohnt hatten. Vier bis fünf Familien erhielten so ein Haus zugewiesen. Wir bekamen den strengen Befehl, den Ort nicht zu verlassen. Nur Kommitteeangehörige und Mitglieder der jüdischen Polizei hatten Sonderausweise, welche sie berechtigten, in ganz Transnistrien herumzureisen, dem Raum zwischen Dnjestr und Bug, der ein einziges jüdisches Anhaltelager bildete.
Die Verpflegung, die das jüdische Komitee austeilte, war kümmerlich genug. In der Hauptsache gab es nur Brot und Suppe. Da wir bei diesem endlosen Transport unsere Lebensmittelvorräte aufgezehrt hatten, befiel uns bald großer Hunger.
Ich wurde am nächsten Tag bei den Straßenarbeiten eingesetzt. Mit einem kurzen Hammer ausgerüstet, hockte ich, dieser Arbeit gänzlich ungewohnt, mit Tausenden anderen in einem der transnistrischen Straßengräben und zerkleinerte in vorsintflutlicher Art und Weise Steine, mit denen die Straßen geschottert werden sollten. Dafür gab es etwas mehr Verpflegung.
Sehr bald brach die Katastrophe aus. Durch die einsetzende Unterernährung und auch durch die leider herrschende Unsauberkeit kam es zu den ersten Typhuserkrankungen. Da wir sehr wenig Ärzte hatten und diese wieder sehr wenig Medikamente, verbreitete sich die Krankheit in Windeseile und raffle Tausende und Tausende hinweg.
Auch ich erkrankte, doch nicht an Typhus, sondern ich hielt die schwere körperliche Arbeit einfach nicht durch und brach – hauptsächlich aus Schwäche – zusammen. Der erste, der mich besuchte war Dr. Katz. Er war abgemagert, und seine Augen lagen tief in den Höhlen. Der Arzt sah selbst aus wie ein Schwerkranker. Trotzdem war er unermüdlich auf den Beinen.
"Nun", sagte er erleichtert, nachdem er mich untersucht hatte, "da haben Sie ja noch einmal Glück gehabt. Ihnen fehlt weiter nichts, Sie sind nur unterernährt."
"Es sollen auch schon Menschen verhungert sein", bemerkte meine Frau bitter.
Der alte Arzt zuckte die Achseln. "Wer zählt sie?" flüsterte er. "Die Erde ist gedüngt mit Juden, auf einen mehr oder weniger kommt es nicht mehr an." Dann aber sprach er uns Mut zu. Die jüdischen Gemeinden in Rumänien hatten sich zu umfassenden Hilfsmaßnahmen für Transnistrien aufgerafft und sandten, soviel sie nur konnten. Die Rumänen ließen die Hilfssendungen völlig ungehindert passieren.
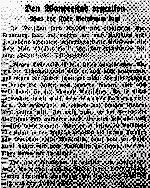 |
| Der "Stürmer". Zum Vergrößern anklicken. |
Ansonsten war unsere Lage wahrhaftig verzweifelt. Die Erde Transnistriens ist unglaublich fruchtbar, sie ist so fett, daß man sie Rahm nennt; Wälder und Weiden wechseln mit großen Ackerflächen und heute nur mehr vereinzelten Obstbaugebieten. Einst wurde diese reiche Gegend der Obstgarten Rußlands genannt. Erst die Kolchosierungvernichtete hier vieles. Die Straßen waren nur zum Teil mit Steinen gepflastert, und so entstanden, besonders nach Regenfällen riesige tiefe Pfützen, so daß der ahnungslose Wanderer, der in sie hineingeriet, manchmal sogar seine Stiefel verlor.
Die Bauern in der Umgebung von Bershad waren, wie wohl in ganz Transnistrien, in der ersten Zeit äußerst ablehnend und uns sehr feindlich gesinnt. Vornehmlich die Jugend, die doch schon im Sowjetsystem geboren und aufgewachsen war, legte einen Antisemitismus an den Tag, der unbeschreiblich war. Hungernde Juden, auch Kinder, die sich in den Dörfern blicken ließen, wurden mit Steinwürfen und hetzenden Hunden verjagt. Die Flugblätter der deutschen und rumänischen Kriegspropaganda wurden von den Bauern begeistert aufgenommen. Vor allem die Versicherung, daß der Krieg nicht gegen die Russen, sondern nur gegen die Kommunisten und Juden geführt würde, und das Versprechen, daß die enteigneten Bauern ihren Grund und Boden zurückerhalten und die Kolchosen wieder aufgelöst würden, fanden helle Zustimmung. Rücksichtslos zeigten die transnistrischen Bauern die sowjetischen Partisanen an oder lieferten sie sogar aus, wenn sie Schutz bei ihren Landsleuten suchten.
Erst später, als niemand Anstalten machte, den Boden den Bauern wieder zurückzugeben, und als die jungen Burschen zum rumänischen Militär einrücken mußten, war die Begeisterung merklich gedämpft, verwandelte sich bald in Ablehnung und schlug schließlich in Haß um. Die Bauern fühlten sich, nicht zu Unrecht, von der Propaganda betrogen und genarrt. Hätten die Rumänen und natürlich in erster Linie die Deutschen ihre Versprechungen, die sie den Bauern in der Sowjetunion machten, auch erfüllt, dann wäre es wohl um das Sowjetsystem sehr schlecht bestellt gewesen.
Die allgemeine Enttäuschung lockerte die Spannungen zwischen uns Juden und den transnistrischen Bauern, die zusehends freundlicher wurden.
Die Hilfsaktionen kamen leider nicht recht zum Tragen. Obgleich die jüdischen Gemeinden in Alt-Rumänien sehr viel aufbrachten, kam nur wenig zur Verteilung. Die Geschenkpakete, besonders die der allgemeinen Sammlung, wurden vom Judenkomitee in eigener Regie verwaltet. Weder die Rumänen noch die Deutschen redeten hier etwas drein. Trotzdem erhielten wir nur einen Bruchteil von jenen Spenden, die unsere Glaubensbrüder aus Rumänien sandten. Der Großteil verschwand spurlos und wurde später zu horrenden Preisen verschoben. Erst viel später, als nach Jahren die Rote Armee wieder in Transnistrien einrückte, erfuhren wir, welch ungeheures Verbrechen unsere eigenen Brüder an uns verübt hatten. Mitglieder des Bershader Judenkomitees, eines aus Siebenbürgen, eines aus der Bukowina, wurden 1945 von sowjetischen Militärgerichten wegen dieser Betrügereien und Unterschlagungen sowie wegen Zusammenarbeit mit dem Feind zu schweren Zuchthausstrafen verurteilt.
Langsam genas ich wieder, wenn auch eine große Schwäche zurückblieb. Mit dem Steineklopfen ging es nicht mehr. Verzweifelt sah ich mich nach einer anderen Möglichkeit um, unsere Lebensmittelration zu erhöhen.
Wirtschaftlich waren die hier zusammengedrängten Juden sich gänzlich selbst überlassen. Die Handwerker, vor allem die Schneider, Schuster und Kürschner, begannen wieder zu arbeiten, und ihre Kundschaft bildeten nicht nur die verbannten Juden, sondern auch die russischen und rumänischen Bauern, die ihrer Scholle treu geblieben waren.
Jedoch neben den jüdischen Handwerkern, die bald erheblich besser lebten als die Masse der verbannten Juden, kristallisierten sich auch andere Gruppen heraus, denen es gelang, sich weit über das Elendsniveau ihrer Leidensgenossen zu erheben: in erster Linie natürlich die Mitglieder und Mitarbeiter der jüdischen Komitees, nicht zuletzt die Angehörigen der jüdischen Polizei, denen ja auch die Verteilung der kümmerlichen Lebensmittelrationen und der immer wieder einlaufenden Hilfssendungen der rumänischen Juden oblag. Sehr bald beobachteten wir erbittert, daß es zweierlei Verbannte gab: jene, die beinahe verhungerten, und andere wieder, die sich‘s "richteten". Daneben tauchten besonders tüchtige Schwarz- und Schleichhändler auf, denen es zum Teil hier in der transnistrischen Verbannung besser ging als zu Hause.
Jene jüdischen Hyänen, die unmenschlich genug waren, noch vom jüdischen Unglück zu profitieren, nahmen ihren Leidensgenossen die letzten Werte ab, die diese hierher völlig unbehindert von den Rumänen und den Deutschen gerettet hatten. Menschen, die dem Verhungern nahe waren, zahlten für Lebensmittel oft pures Gold.
Es war ein Jammer, zu sehen, daß das Elend, die entsetzliche Not, oft die primitivste Menschlichkeit vernichtete. Der Tanz um das Goldene Kalb war nirgendwo so abstoßend wie hier am Rande des Abgrundes. Später, als wir wieder einmal befreit wurden, diesmal von neuem durch die Sowjetarmee, blieben Zehntausende und Zehntausende von Gräbern elend zugrunde gegangener Juden in Transnistrien zurück. Fast alle schleppten wir ins weitere Leben nicht nur unaustilgbare Erinnerungen mit, sondern auch schwere gesundheitliche Schäden, mit denen die meisten nie mehr fertig werden.
Andere freilich trugen in ihren Säcken keuchend goldene Ringe, Uhren und Golddukaten mit sich. Den Blutlohn eines brudermörderischen Schleichhandels. Allein ich will den Dingen nicht voraus eilen.
Wir befanden uns in dem Städtchen Bershad in einer besonderen Lage. Da wir von der Zentralverwaltung Mogilew sehr weit entfernt waren, hatten wir zum Teil größere Freiheiten und mehr Bewegungsmöglichkeiten. Auf der anderen Seite lebten wir nahe dem Flußlauf des Bugs aber auch gefährlicher. Wer sich nämlich in Transnistrien eines Vergehens schuldig machte, wurde über den Bug geschickt. Das bedeutete in der Regel den sicheren Tod. Die deutsche Zivilverwaltung, die hinter dem Bug begann, machte mit den Strafverschickten nicht viel Federlesens. Meist wurden sie kurzerhand erschossen.
Die Vergehen waren mannigfaltiger Art: schwere Gewalttaten, Raub, Diebstahl. Doch auch eine grobe Beleidigung des jüdischen Komitees oder der jüdischen Polizei konnte schon dazu führen, daß diese den Übeltäter beim rumänischen Kommando anzeigten. Da sich die Rumänen um uns im großen und ganzen überhaupt nicht kümmerten, waren es ja in erster Linie das jüdische Komitee selbst und seine Polizei, die indirekt bestimmten, wer über den Bug mußte und wer nicht. Die direkte Entscheidung traf der rumänische Ortskommandant. Gewöhnlich entschied er so, wie das jüdische Komitee und die Polizei es vorschlugen.
Es gab aber noch andere Vergehen, wegen deren man leicht das Leben verlieren konnte: Übertretung der Sperrstunde etwa. Die Zeiten dieser Sperrstunde wurden sehr unterschiedlich gehandhabt. Im allgemeinen durfte man nach einundzwanzig Uhr nicht mehr die Straßen betreten. Doch lief der Verkehr oftmals bis zweiundzwanzig Uhr.
Zwei junge Juden waren eines Tages leichtsinnig und hatten sich weit über die Sperrstunde hinaus verspätet. Sie wurden von einer rumänischen Patrouille ertappt, festgenommen und ins Gefängnis eingeliefert. Einer der beiden war mein Freund. Nun wollten die Rumänen, um dem Gebot der Sperrstunde wieder einmal mehr Nachdruck zu verleihen, ein Exempel statuieren und die beiden über den Bug schicken. Schon zwei Tage saßen die Delinquenten im Gefängnis, und sie hatten praktisch bereits mit ihrem Leben abgeschlossen. Mein Freund, Kantor und Absolvent der Mailänder Scala, begann zum Abschied von diesem Leben religiöse Lieder zu singen. Er hatte eine herrliche Stimme.
Bald lauschte das ganze Gefängnis und auch der im oberen Stockwerk diensttuende rumänische Offizier. Da er gerade Langeweile hatte, erkundigte er sich nach dem Sänger und ließ ihn vorführen. Er fragte ihn, ob er auch rumänische Lieder singen könne. Mein Freund bejahte und sang einige rumänische Volkslieder. Der Offizier war so begeistert, daß er kurz entschlossen entschied, daß mein Freund nicht über den Bug müsse.
Der so jählings Begnadete holte erst einmal tief Atem und sagte dann tapfer: "Ich weiß nicht, wie ich danken soll, doch ich kann allein die Gnade nicht annehmen. Wenn ich nun freikommeund mein Kamerad über den Bug geht, wird mich die Gemeinde als Verräter ausstoßen."
Der rumänische Offizier stutzte und sandte meinen Freund wortlos in die Zelle zurück.
Am nächsten Morgen wurden beide freigelassen. So kam es, daß mein Freund im weiteren Verlaufe bei manchem Zechgelage der rumänischen Offiziere singen mußte. Damit erleichterte er sich und seiner Familie das Leben sehr.
Selbst hier, sozusagen am Ende der Welt, verfolgten wir mit atemloser Spannung das Weltgeschehen. Natürlich war es uns streng verboten, Radioapparate zu besitzen und zu benutzen. Doch wir hatten sie und hörten die Rundfunkmeldungen der ganzen Welt. Wir waren sehr bald über die großen Schwierigkeiten im Bilde, denen Hitler, besser gesagt seine Armeen, in der unendlichen russischen Weite begegneten.
Aber wir waren nicht einmal auf die Rundfunknachrichten angewiesen. Da die Juden in Rumänien alle Freiheiten genossen und ausgezeichnete Verbindungen in aller Welt hatten, waren wir auch laufend über Zusammenhänge und Hintergründe unterrichtet, von denen der Durchschnittsbürger kaum etwas wußte. Unsere Verbindung zur Bukarester jüdischen Gemeinde florierte ausgezeichnet. Zum Teil standen wir auch durch Kuriere, die nicht nur die rumänische Armee passierten, sondern auch die ganze deutsche Ostfront, immer wieder mit den Juden in der Sowjetunion in gutem Kontakt.
Obgleich wir längst alle Illusionen verloren hatten und uns das unerbittliche Schicksal eine ansehnliche Portion Skepsis aufzwang, konnten wir doch allmählich erkennen, daß der Stern Adolf Hitlers im Sinken war. Was uns all die Jahre vorher unmöglich schien, wurde nun Wahrheit.
Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken. Nachdem ich mich von der Straßenarbeit befreit hatte, bemühte ich mich, auf irgendeine Art und Weise meine kleine Familie über Wasser zu halten. Obschon ich Handarbeiter bin, konnte ich mein erlerntes Handwerk dort nicht ausüben. Buchbindereien gab es nicht.
Zum Handel hatte ich nicht die geringste Eignung. Dazu kam, daß ich voll Ekel auf jene Geschäftstüchtigen blickte, die sich nicht schämten, die Folgen des mörderischen Antisemitismus auszunützen und ihre eigenen Leidensgenossen auszubeuten.
So verfiel ich auf einen etwas sonderbaren Ausweg. Ich las den russischen und rumänischen Bauern allabendlich aus der Bibel vor. Da die meisten des Lesens und Schreibens nicht kundig waren, erlangten meine Besuche bald große Beliebtheit. Natürlich übersetzte oder las ich auch andere, weltliche Dinge, wie es eben kam. Da jedoch die Bauern nur abends Zeit hatten, so mußte ich beinahe jede Nacht mein Leben riskieren und, ob ich wollte oder nicht, die Sperrstunde übertreten.
Später lernte ich sogar Karten schlagen. Und wie ein Zigeuner zog ich in der weiteren und näheren Umgebung von Bershad umher, bald mit der Bibel unter dem Arm, bald mit einem Paket abgegriffener Spielkarten.
Was tut der Mensch nicht alles, wenn er mit Weib und Kind überleben will? Daß ich dabei weder als Angehöriger der jüdischen Polizei noch als Schleichhändler mich gegen die Interessen meiner Leidensgenossen stellen mußte, war mir allein moralischer Gradmesser für mein Tun.
Mein Honorar war bescheiden genug. Ein paar Handvoll Mais, wir nannten ihn Kukuruz, ein paar Kartoffeln oder ein Fläschchen Milch. Was für kostbare Reichtümer waren das! Man mußte mit ihnen obendrein vorsichtig und verstohlen umgehen. Denn der Neid, den das Elend geschaffen hatte, war auch in den Reihen der Leidensgenossen unsagbar groß.
Heute kommt mir in der Erinnerung jene Zeit wie ein Märchen vor. Ein grausames und leider oft blutiges Märchen. Trotzdem, eines blieb Wirklichkeit: Wir überlebten.
Eines Abends, ich war gerade etwas früher als sonst nach Hause gekommen und hatte meiner Frau meine Schätze ausgehändigt, pochte es ungestüm an unsere Zimmertür.
Meine Frau öffnete erstaunt, und herein stürzte Dr. Katz. "Gebt mir Unterkunft!" keuchte er. "Mich haben die Wulechs gejagt. Ich habe keine Lust, über den Bug zu gehen. Jetzt wo es an den Fronten so schlecht steht, werden die noch ganz verrückt mit ihrer Sperrstunde."
Selbstverständlich luden wir Dr. Katz ein, bei uns zu bleiben. Ich war froh, wieder einmal einen Bekannten lebend zu sehen.
"Nicht daß ihr glaubt", sagte der Alte, nachdem er sich einigermaßen erholt hatte, "daß ich mit leeren Händen komme." Er öffnete seine große Tasche, in der er sein ärztliches Besteck und die wenigen Medikamente bewahrte, die er hatte, und zog aus ihr triumphierend ein Stück Speck hervor. "Etwas Brot habe ich auch."
Das war nun wahrhaftig eine freudige Überraschung, denn sehr gut ging es uns ja noch immer nicht. Wir waren froh, nicht verhungern zu müssen. So legten wir alles zusammen, das wenige, das auch wir hatten, und aßen uns nach langer Zeit wieder einmal richtiggehend satt.
Dr. Katz scherzte mit meinem Sohn, und erst als sich dieser schlafen gelegt hatte, sagte er bekümmert: "Es schaut nicht aus, als ob das Schlamassel bald enden würde."
Wir nickten niedergeschlagen. Nirgendwo war ein Ende abzusehen. Ein Teil der Familie meiner Frau befand sich in Bar, das liegt in Rußland. Dort konnte man überhaupt nicht hin. Andere Verwandte lebten in Balti und Lipkani in Bessarabien. Ich hatte mich unter sehr schwierigen Umständen aufgemacht, nach der Familie zu forschen. Zwar war es uns streng verboten, uns vom Verbannungsort zu entfernen, doch es gab immer wieder eine Möglichkeit dieses Verbot zu durchbrechen. Vor allem dankten wir diese Möglichkeiten jenen jüdischen Mädchen und Frauen, die als Gäste ins rumänische Offizierskasino gingen und oft sogar über den Bug hinüber eingeladen wurden, eine Einladung, die wirmehr als alles fürchteten. Denn die meisten Juden, die über den Bug mußten, wurden erschossen. Diese Frauen brachten nicht nur Geld und Lebensmittel nach Hause, sondern es gelang ihnen da und dort, von rumänischen und selbst von deutschen Offizieren sogenannte SS-Ausweise zu erbitten. Mit diesen Ausweisen konnte man sich in ganz Transnistrien völlig frei bewegen. Zwar galten die SS-Ausweise nur für beschränkte Zeit, doch waren sie sehr leicht zu fälschen. Natürlich konnten nur einige wenige solcher Ausweise von uns erobert werden. Eine junge, schöne Frau namens Rita lebte mehrere Jahre in unserer nächsten Umgebung mit einem rumänischen Unteroffizier zusammen. Manche sahen sie deshalb über die Schulter an und verfluchten sie. Man befürchtete in der Gemeinde, daß sich zu viele Frauen mit Rumänen einlassen würden. Frau Rita aber, eine Esther im kleinen, half nicht nur ihrer Familie, sondern zahlreichen Juden.
Vor Lipkani war ich einem Zug von etwa 5000 Juden begegnet, die, von einem rumänischen und einem deutschen Soldaten bewacht, über Balti ins Ungewisse zogen. Erstarrt beobachtete ich, wie diese Tausende sich willenlos dem Kommando der beiden Soldaten fügten. Die Schwachen und Alten, die den Strapazen nicht gewachsen waren und zusammenbrachen, wurden von dem deutschen Soldaten kurzerhand erschossen. Es war ein Inferno, dabei ein unfaßbares, denn die Tausende hätten den einen Mann mit Leichtigkeit mit ihren Händen erwürgen können; aber niemand hob die Hand.
In Lipkani sprach ich bei der deutschen Kommandantur vor, erkundigte mich nach meinen Verwandten und berichtete einem dort diensthabenden österreichischen Offizier meine Beobachtungen. Er war darüber aufgebracht, allein er sagte, daß er nichts dagegen tun könne. Eindringlich warnte er mich, weiter zu suchen. "Gehen Sie zurück", sagte er, "hier ist alles hoffnungslos." Es war wirklich kein Ende abzusehen.
Wer will die Vernichtung?
"Wie nur ein Mensch soviel Unglück über die anderen bringen kann", klagte meine Frau.
"Ich fürchte", widersprach ich, "es ist nicht nur ein Mensch. Vielleicht ist es auch gar nicht nur ein Volk."
"Na, na", entgegnete Dr. Katz entrüstet, "Sie werden doch nicht am Ende die Deutschen verteidigen wollen?"
"Daran denke ich nicht im Traum. Aber sind es nur die Deutschen? Es heißt zwar, sie hätten den Affen erfunden. Den Antisemitismus erfanden sie sicherlich nicht. Immer wenn es den Romanows schlecht ging, haben die Zaren den Völkern ihre Juden zum Fraße vorgeworfen. Die Pogrome waren stets das Ventil für die aufgespeicherte Volkswut. Und die Spanier? Ihr Torquemada ließ den Juden nur zwei Möglichkeiten: Taufe oder Vertreibung. Kaum einer, der heute vor den kirchlichen Wunderbauten in Sevilla, Granada, Toledo und anderswo steht, weiß, daß diese Bauten vor rund 500 Jahren Synagogen waren. Und was war in Frankreich los? Lange ehe in Deutschland der Antisemitismus explodierte, raste er in Paris. Der arme Hauptmann Dreyfus wurde ans Kreuz geschlagen, weil er ein Jude war. Das war seine ganze Schuld.
Wie war es 1936 in Bessarabien, als die schwere Hungersnot ausbrach? Damals waren noch keine Deutschen im Lande, und gegen wen richtete sich der Volkshaß? Gegen uns Juden. Die antisemitischen Hetzer stachelten die Bauern gegen uns auf und klagten uns an, daß wir für die Hungersnot verantwortlich wären."
"Das ist schon richtig", räumte Dr. Katz ein, "und trotzdem ist es falsch. Torquemada ließ wenigstens den Juden die Entscheidung:
Taufe oder Vertreibung. So entstanden aus jenen Juden, die sich beugten, die Maranen, die dem spanischen Staat später wertvolle Dienste leisteten. Die Deutschen dagegen, die gaben uns keine Entscheidungsmöglichkeit; sie wollen uns vernichten!"
"So ist es", stimmte meine Frau erregt bei.
"Wollen wir uns gegenseitig Propagandareden halten?" fragte ich ruhig. "Oder wollen wir über die Wahrheit diskutieren? Stundenlang liege ich oft in den Nächten wach und grübele nach. Und mit mir hier in Transnistrien viele Zehntausende von Juden. Ich bin überzeugt, nicht nur in Transnistrien. Immer wieder frage ich mich, wie kam es so weit? Immer wieder sinne ich darüber nach, ob es wirklich so hat kommen müssen. All die Jahre, schon in Lemberg, und natürlich in Czernowitz, habe ich begierig alle Nachrichten gesammelt, die die Frage, ob es so kommen mußte oder nicht, berühren. Und ich sage euch: Es hat nicht so kommen müssen. Selbstredend wollten die Nazis die Juden aus Deutschland draußen haben. Sie wollten die Juden vertreiben. Aber von einer Vernichtung war damals keine Rede."
"Wie können Sie so etwas sagen?" Dr. Katz sprang auf. "Sind Sie wahnsinnig geworden?"
"Oft, wenn ich so nachdenke, fürchte ich den Verstand zu verlieren. Es ist grauenhaft, den Tatsachen ins Auge zu blicken. Und Tatsachen sind die wiederholten Anstrengungen, die die Nazis machten, um die Auswanderung der Juden in die Wege zu leiten. 1934 verließen mit all ihrer beweglichen Habe 120 000 Juden Deutschland in Richtung Palästina."
"120 000", höhnte Dr. Katz, "ein Bruchteil!"
"Das stimmt", gab ich zu. "Aber warum nur ein Bruchteil? Es ist doch Tatsache, daß die Reichsregierung jeden Juden auswandern ließ. Warum es nur 120 000 waren? Das ist leicht zu erklären. Weil die Engländer nur diesen 120 000 die Einreiseerlaubnis nach Palästina gaben. Hätten sie für alle Juden Zertifikate ausgestellt, der Hitler wäre froh gewesen, sie loszuwerden. Abgesehen davon, es wäre auch ein großes Geschäft für ihn gewesen, denn die Liegenschaften wollten die Nazis ja sowieso nicht hergeben. Jedoch am Leben wären alle geblieben."
"Also der Tote ist schuld und nicht der Mörder", spottete Dr. Katz.
"So löst man keine Frage, die Leben und Tod der Juden in sich trägt. Bekanntlich entstand sogar innerhalb der NSDAP, besonders um den berüchtigten Julius Streicher, eine Gruppierung von Parteigenossen die mit dieser Auswanderung ganz und gar nicht zufrieden waren, und kein geringerer als Dr. Goebbels mußte in einer öffentlichen Rundfunkansprache den unzufriedenen radikalen Antisemitengegenüber die Ausreiseerlaubnis verteidigen. Er sagte ironisch: 'Laßt doch die Juden nach Palästina ziehen, die werden sich dort gegenseitig auffressen!'"
"Was folgern Sie daraus?"
"Hätte man diese Möglichkeit aufgegriffen, hätte man verhandelt, und hätte man auf die Regierungen der Welt einen Druck ausgeübt, daß sie die Juden überhaupt aufzunehmen bereit waren, dann wären den Juden in Deutschland Verfolgung und Konzentrationslager erspart geblieben."
"Und wer ist dann schuld?" fragte Dr. Katz aufgeregt.
"Natürlich in erster Linie die deutsche Regierung, die die Judengesetze geschaffen hat. Dann aber jene, die nichts taten, um die Juden zu retten! Jahrelang herrschte noch Friede, jahrelang hätte man jeden Juden aus dem Einflußgebiet Hitlers herausbringen können. Als dann der Krieg ausbrach, war es zu spät. Die Engländer haben aus Angst vor den Arabern, aus Berechnung im Hinblick auf ihre kolonialen Interessen den Juden ihre Schutzherrschaft aufgekündigt. Sie verweigerten ihnen den Zuzug nach Palästina, obwohl sie alle Macht dort hatten. Selbst nach dem Einmarsch der Deutschen in Osterreich und der Tschechoslowakei reisten mit offizieller deutscher Bewilligung jüdische Auswanderertransporte über Jugoslawien, Rumänien und Griechenland ins Mittelmeer. Zum Teil entließen die Nazis Juden selbst aus den Konzentrationslagern und Gefängnissen, wenn sie auswanderten.
Es ist sicher, daß mindestens zwanzig jüdische Auswanderungstransporte von je etwa tausend Seelen in der Zeit von 1939 bis 1940 Prag und Wien verließen. Die Engländer aber eröffneten mit ihren Patrouillenbooten das Feuer auf diese illegalen Einwanderungs-Schiffe, verwundeten und töteten jene Juden, die den Nazis entkommen waren, oder nahmen sie gefangen und hielten sie hinter Stacheldrähten, bis sie schließlich die illegale Einwanderung ganz unter banden. Die Engländer weigerten sich also, die jüdische Masseneinwanderung nach Palästina zu gestatten."
An der Tür pochte es.
"Entschuldigen Sie", Salomon, ein junger Händlerssohn, der seine ganze Familie außer einer Schwester verloren hatte und in einem rückwärtigen Verschlag des Hauses schlief, trat in unseren Wohnraum. "Ich hörte Sie sprechen, und", gestand er verlegen, "ich habe gehorcht." Auf seinen Wangen brannten hektische rote Flecken. "Hätte man da nicht versuchen müssen, die Juden in andere Länder zu bringen?"
Meine Frau rückte einen Stuhl zurecht und goß eine Tasse Tee ein. Der Junge trank begierig und starrte mich fragend an.
"Das ist ja geschehen", versuchte ich zu erklären. "1935 trugen sich in Deutschland weitere hunderttausend Juden zur Auswanderung ein. Die Nazibehörden erlaubten auch diese Ausreisen. Ich brauche mich dazu nicht zu äußern, ich habe alle Unterlagen gesammelt."
Ich stand auf und holte unter meinem Bett die Mappe hervor, die mich nun schon jahrelang begleitete. "Hier, am 15. Januar 1936 schrieb die Bukarester Zeitung 'Tara noastra' [Unser Land] unter dem Titel 'Juden aus Deutschland – niemand will sie haben'."
Ich nahm das vergilbte Zeitungsblatt und begann vorzulesen:
"Über 100 000 Juden schicken sich an, Deutschland zu verlassen. Das Sekretariat des Völkerbundes bemüht sich, wie immer unter solchen Umständen, auf diplomatischem Weg und unter der Hand ein Land zu finden, welches diese reisende und nach Komfort suchende Bevölkerung aufnimmt. Nach dem 'Daily Herald' aus London studiert man gegenwärtig einen internationalen Plan für die Unterbringung dieser 100 000 Juden, die demnächst Deutschland verlassen werden. Die Kosten sollen aus einem Spezialfonds von zehn Millionen Pfund bestritten werden. Dieser Fonds wird aufgebracht unter der Schirmherrschaft eines eigenen Komitees unter der Leitung von Sir H. Samuel Lord Beasdorf und Samuel Marx. Die Gelder sollen nicht nur zur Bestreitung der Reisekosten, sondern auch zur Erledigung aller sonstigen Formalitäten dienen. Die 100 000 Juden sollen auf verschiedene Länder verteilt werden, welche ihnen die Tore öffnen wollen. Auf eine Anfrage wegen Aufnahme dieser Flüchtlinge aus Deutschland hat Frankreich eine abschlägigeAntwort erteilt. Im übrigen weist die französische Presse darauf hin, daß die ersten Flüchtlinge aus Deutschland, die die Erlaubnis zur Ansiedlung in Korsika erhalten hätten, alle nach kurzer Zeit nach Frankreich zurückkehrten. Nun sollen uns in Rumänien dreißigtausend davon zugedacht sein. Eine zweite Kolonisierung.'"
In dem kleinen Raum war es so still, daß man ein Blatt hätte zu Boden fallen hören.
"So ist es", stöhnte der Junge, der noch keine neunzehn Jahre alt war, aber aussah wie ein schwergeprüfter Mann. "Niemand will uns haben."
"Am 15. September 1935 beschloß das Dritte Reich", fuhr ich fort, "die Nürnberger Gesetze. Sie bedeuteten nicht mehr und nicht weniger als eine Trennung der Deutschen von den Juden. 'Reichsbürger ist nur der Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes, der durch sein Verhalten beweist, daß er gewillt und geeignet ist, in Treue dem deutschen Volk und Reich zu dienen.' Und: 'Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten.'
Stand die Welt vielleicht auf? Verfluchte sie deswegen Deutschland und vor allem Hitler? Kein Gedanke daran! Sie fuhren nach München und machten ihren Pakt, die Engländer und die Franzosen, und später dann haben die Sowjetrussen ihren Pakt geschlossen. Und das jüdische Schicksal war denen allesamt völlig egal. Erst als ihre eigenen Interessen auf dem Spiel standen, da erinnerten sie sich der Juden. Vorher war das Echo groß. Selbst der Christliche Verein junger Männer in Warschau führte augenblicklich einen Arierparagraphen ein und verschloß den Juden seine sportlichen Einrichtungen und Badeanstalten."
"Ist das wahr?" fragte Salomon ungläubig.
Ich reichte ihm die Zeitung hinüber. Die Meldung war in der in London herausgegebenen jüdischen Zeitung "World Jewry" vom 17. Januar 1936 erschienen.
"Gar nicht zu reden von dem, was die Ukrainer aufführten. Als das polnische Unterrichtsministerium Ende 1935, Anfang 1936 den Lehrstuhl für organische Chemie in Lemberg dem aus Deutschland emigrierten Professor Fayans übergeben wollte, bewarfen die ukrainischen und polnischen Studenten den Professor mit faulen Eiern und machten die Vorlesungen unmöglich. Die in Czernowitz erscheinende 'Deutsche Tagespost', das Organ der Bukowiner Deutschen, erklärte den Vorfall am 12. Januar 1936 lakonisch: 'Fayans ist Jude.'"
"Ja, bei den Ukrainern", sagte Dr. Katz gedankenschwer, "da mußte man immer auf alles gefaßt sein."
"Nur bei den Ukrainern?" Ich blätterte in meiner Mappe weiter. "Der in seiner Mehrheit sozialdemokratische Stadtrat von Zürich wendete sich gestern gegen die bisherige Handhabung der Einbürgerung von Ausländern. Seit Monaten werden schon in Gemeinden und Kantonen Beschlüsse gefaßt, die die Erteilung von Einbürgerungen von Ausländern entweder ganz unterbinden oder einschränken. Besonders aus Deutschland wanderten viele jüdische Emigranten zu.‘ So berichtete ironisch die in Zürich erscheinende Zeitung "De Front" vom 18. Juli 1936. Doch nicht nur über die Schweiz, hören Sie zu, aus Santiago de Chile, der Hauptstadt Chiles, wird berichtet, daß das chilenische Außenministerium Maßnahmen getroffen habe, um die immer bedrohlicher werdende jüdische Einwanderung einzuschränken. Und die Regierung von Paraguay verbot 1936 die Einwanderung für Juden ohne Unterschied der Staatsangehörigkeit; sogar für solche, die bereits im Besitz des Visums waren und die Reise schon angetreten hatten. Im selben Jahr 1936 verbot der rumänische Unterrichtsminister Anghelescu den jüdischen Religionslehrern den Unterricht an den Staatsschulen. Jeder Versuch, die antisemitische Hetze zu unterbinden, wurde unterdrückt. Die ostjüdische Zeitung von Czernowitz berichtete am 30. Juli 1937, daß die Staatsanwaltschaft ihren Herausgeber und Chefredakteur, den Führer des rumänischen Zionismus, Dr. Meyer Ebner, verständigt hätte, seine Eingabe, man möge den Vertrieb des aus Deutschland eingeführten 'Stürmers' nicht erlauben, sei abgewiesen. Wahrhaftig, wir hatten keine Freunde in der Welt. Oder wenigstens keine einflußreichen. Die Juden waren auf Gedeih und Verderb zumindest in Deutschland Hitler ausgeliefert."
"Na also", rief Dr. Katz erleichtert aus, "Sie sagen es ja selbst."
Ich nickte. "Hat man entsprechend verfahren? Schon im Oktober 1934 war der langjährige politische Ratgeber des britischen Generals Allenby, ein genauer Kenner der Palästinafrage, ein Colonel Meinertzhagen, in Berlin und sprach wegen der Judenfrage bei Hitler vor. Hitler soll sich über das private Schicksal der Juden in Deutschland bedauernd geäußert haben und sich mit einer Auswanderung bei Mitnahme eines Vermögens von 1000 englischen Pfund und von Waren im Werte von 20 000 Reichsmark einverstanden erklärt haben.
Meinertzhagen verständigte sofort Chaim Weizmann von dieser Chance. Weizmann stellte augenblicklich die Gegenforderung: Mitnahme des ganzen jüdischen Vermögens und Errichtung von gewerblichen Umschulungskursen und hebräischen Sprachkursen für die jüdischen Kinder. Weizmann hatte nur die Emigration nachPalästina ins Auge gefaßt, sonstnichts. Tatsächlich reiste der Engländer noch einmal nach Berlin und hatte eine neuerliche Aussprache mit Hitler in Gegenwart von Ribbentrop und Heß. Besonders ließ war sehr aufgeschlossen, und Ribbentrop versicherte Meinertzhagen, daß die Reichsregierung und die Leitung der Reichsbank jedem vernünftigen Vorschlag in Fragen der jüdischen Auswanderung zustimmen würden. Jedoch wäre es unmöglich für die Reichsregierung, mit Chaim Weizmann oder einem anderen Juden darüber zu verhandeln. Ribbentrop schlug vor, daß eine Regierung als Treuhänder der Juden darüber entscheiden möge.
Der Engländer reiste augenblicklich ab und erstattete Weizmann einen eingehenden Bericht. Dieser maßgeblichste Zionistenführer geriet in Wut und sagte scharf: 'Mich würde es wenig genieren, wenn über Deutschland die Cholera oder der Bolschewismus käme. Meinetwegen können über die Deutschen beide Plagen kommen.' Und: 'Eher will ich den Untergang der deutschen Juden sehen als den Untergang des Landes Israel für die Juden.'"
Das Schweigen im Raum nach diesen Worten wurde drückend.
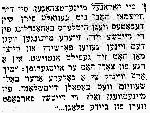 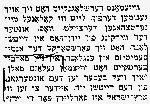 |
| Erklärung Chaim Weizmann. Zum Vergrößern anklicken. |
"Das ist ungeheuerlich", flüsterte Salomon.
"Weizmann wollte eben nur sein zionistisches Konzept verwirklichen, das Schicksal der deutschen Juden bekümmerte ihn herzlich wenig."
"Ich bin nicht in der Lage, darauf zu antworten", stieß Dr. Katz hervor.
"Es braucht gar keine Antwort", sagte ich milde. "Sie sehen ja, die Entwicklung hat uns die schrecklichste Antwort gegeben, die es überhaupt gibt."
Im Flur entstand ein Geräusch. Ich sprang auf. Bisher hatten wir in unseren Häusern völlig unbehelligt gelebt. Aber möglich war schließlich alles. Jedoch es waren nicht die Rumänen und schon gar nicht die Deutschen, sondern es war unser Nachbar Isaak, der voller Aufregung hereinstürzte.
"Ich weiß nicht ein und nicht aus", schrie er und raufte sich die Haare, "Rosa geht es so schlecht, und die Frauen in unserem Haus können ihr nicht helfen. Wenn ich nur irgendwo einen Arzt herbekame."
Trotz der Verzweiflung des braven Ehegatten, dessen junge Frau zum erstenmal ihrer schweren Stunde entgegensah, brachen wir in ein fröhliches Gelächter aus.
Dr. Katz erhob sich, griff nach seiner Tasche. "Wie weit ist das?"
Entgeistert starrte Isaak den Arzt an. Als er endlich begriff, fiel er ihm weinend um den Hals.
"Nun, Jüngelchen, reg dich nicht auf", sagte Dr. Katz gelassen, "schließlich kriegt ja deine Frau das Kind und nicht du." Eilig verließen beide die Stube.
"Wenn man über all das nachdenkt, was Sie soeben berichtet haben", setzte der Junge das Gespräch fort, "wird man glatt verrückt."
Ich nickte. Dazu gab es nichts zu sagen.
Zu unser aller Überraschung kam Dr. Katz bald wieder zurück und setzte sich an den Tisch. "Wenn Sie noch eine Tasse Tee hätten", bat er meine Frau.
"Ist etwas passiert?" fragte diese erschrocken.
Der alte Doktor lachte. "Es ist immer das gleiche. Sie kennen doch die Geschichte von der Tochter des Holzhändlers, der nach dem ersten Weltkrieg steinreich wurde. So reich, daß ihm die jüdischen Kreise gar nicht mehr paßten und er nur einen Schwiegersohn nahm, der bereits assimiliert war. Bei dem war es so vornehm, daß in seinem Haus weder deutsch noch jiddisch gesprochen werden durfte, sondern nur polnisch. Darum wurde auch, als die Stunde da war, kein jüdischer Arzt geholt, sondern ein bekannter polnischer Gynäkologe. Der untersuchte die werdende Mutter und begab sich dann gemächlich ins Wohnzimmer. 'Wir haben noch Zeit', beruhigte er den aufgeregten Gatten.
Sie saßen beieinander und tranken Kognak. Aus dem Schlafzimmer rief die junge Frau in polnischer Sprache: 'Lieber Herrgott, hilf!'
Ihr Mann erhob sich nervös, aber der Professor lächelte: 'Bleiben Sie sitzen! Wir haben noch viel Zeit.'
Etwas später stöhnte die Frau in deutscher Sprache: 'Lieber Herrgott, hilf!'
Mit Schweiß auf der Stirne sprang ihr Mann auf und drängte: 'Herr Professor, Sie werden benötigt!'
Der erfahrene Arzt lächelte: 'Keineswegs! Wir haben noch immer Zeit.'
Wieder saßen die Männer und tranken, da schrie die junge Frau plötzlich in jiddischer Sprache: 'Mutter, Mutter, hilf!' Jetzt erhob sich der Arzt, stellte das Glas weg und verlangte nach heißem Wasser, 'denn', sagte er, 'jetzt ist es Zeit!'
Die brave Rosa da drüben", lächelte Dr. Katz, "die ist erst bei der polnischen Sprache angelangt. Ich kann in Ruhe meine Tasse Tee austrinken und die Diskussion mit euch beenden, weil mir die Sache schwer im Magen liegt, die wir eben besprochen haben."
"Mir nicht weniger", erwiderte ich.
Salomon fragte: "Haben Sie mehr solche Sachen aufgehoben?"
Ich nickte. "Die jüdische Zeitung 'Israel', Rom, schrieb am 14. April 1938: 'Die Regierung in Bolivien hat angekündigt, daß die Tore der Republik für alle Einwanderer offen sind mit Ausnahme der Chinesen, Neger, Juden und anderer verdächtiger Elemente.'"
"Es ist nicht zu fassen", sagte Dr. Katz bitter.
Ich ließ mich dadurch nicht beirren.
"Hier, die Londoner Abendzeitung 'Evening Standard' vom 3. Mai 1938. In ihrem Leitartikel 'Die Nichtbürger' gibt sie ihrer Besorgnis Ausdruck, daß viele jüdische Ärzte und Zahnärzte in England ihre berufliche Praxis ausüben, während dort etwa eineinhalb Millionen Arbeitslose vorhanden seien. Im August 1938 veröffentlichte die in England erscheinende jüdische Zeitung 'Jewish Chronicle' unter anderem, der türkische Gesundheitsminister habe ein offizielles Dementi gegen Falschmeldungen herausgegeben, denn es sei nicht wahr, daß die türkische Regierung beabsichtige, 200 jüdische Professoren und Wissenschaftler aus Österreich anzustellen".
Aus Athen wurde am 6. August 1938 gemeldet: 'Die griechische Regierung verfügte, daß fremden Juden die Einreise nach Griechenland untersagt sei. Die Bestimmung träfe nicht allein jene Juden, die sich in Griechenland aufhalten, um sich dort anzusiedeln, sondern auch die, welche nur zu kurzem, touristischem Aufenthalt dorthinkommen wollen.'"
Dr. Katz schlürfte langsam seinen Tee aus. Der Junge hatte die Augen geschlossen.
"In dieser Situation", fuhr ich fort, "gab Theodore N. Kaufmann in der Argyle Press, Newark, N. Y., im Frühjahr 1941 sein Buch heraus 'Germany must perish', also 'Deutschland muß untergehen'. In diesem Buch schreibt Kaufmann unter anderem wortwörtlich: 'Die Bevölkerung Deutschlands, ausgenommen die der eroberten und einverleibten Gebiete, beträgt ungefähr 70 Millionen, die sich ziemlich gleichmäßig auf Männer und Frauen verteilen. Um den Zweck der deutschen Auslöschung zu erreichen, wäre es erforderlich, nur etwa 48 Millionen zu sterilisieren – eine Zahl, die Männer über 60 Jahre und Frauen über 40 wegen ihrer begrenzten Zeugungsfähigkeit ausschließt."
Dr. Katz lachte schallend. "Wenn man sich das so in der Praxis vorstellt", erläuterte er.
Ich unterbrach ihn, "Ich finde dabei nichts zu lachen. Mir kommt das so vor, als wenn im Zirkus ein paar Lausbuben einen Löwen, zwischen dessen Zähne der Dompteur gerade seinen Kopf gesteckt hat, mit Steinen bewerfen. Ihnen kann ja nichts passieren. Denn zwischen ihnen und der Gefahr liegt ein Ozean beziehungsweise das Gitter des Raubtierkäfigs. Die Juden aber, die sich in Deutschland befinden, beziehungsweise der Dompteur, der seinen Kopf im Rachen des Löwen hat, sind verloren."
"Aber hören Sie", versuchte mich Dr. Katz zu beschwichtigen, "letzten Endes kann doch dieses Buch niemand ernst nehmen. Außerdem ist es ja von einer Privatperson geschrieben."
 |
| Madagaskar-Plan. Zum Vergrößern anklicken. |
"Nun, liebe Freunde", gab ich resigniert zur Antwort, "Herr Goebbels hat es auf alle Fälle ernst genommen – und wie! Mehr noch sein Spießgeselle Streicher. Und Sie sagen, Kaufmann wäre eine Privatperson gewesen? Das ist richtig. Doch auch dafür kann ich Ihnen eine Ergänzung liefern. In der gefährlichsten Lage erklärte Salomon Untermeyer, der im Juli 1933 in Amsterdam zum Präsidenten der 'International Jewish Economic Federation to combat the Hitlerite Oppression of Jews' gewählt wurde, natürlich auch aus der Sicherheit von New York heraus, Hitler den Krieg. Dümmer ging es wohl nicht mehr. Man reizte den Gegner, dem Hunderttausende wehrlos ausgeliefert waren. Zur selben Zeit bemühte sich der britische Premierminister Chamberlain, mit Hitler zu einer Einigung in der Judenfrage zu kommen. Es ging um die Mitnahme des jüdischen Vermögens, das nicht weniger als eine Milliarde Pfund Sterling ausmachte. Das war natürlich eine harte Nuß. Wenn das jüdische Kapital mit einem Schlag aus Deutschland abgezogen worden wäre, wäre Deutschland bankrott gewesen. Aber sie verhandelten. Man plante, die auswandernden Juden in Deutsch-Ostafrika, auf Madagaskar und in British-Guayana anzusiedeln."
"Was hätte das für einen Sinn gehabt?" widersprach Dr. Katz heftig. "Das hätte uns doch nur neuerlich zersplittert, auf diese Weise kommen wir nie nach Zion."
Ich stand auf. Trotz unserer langen Bekanntschaft vermochte ich nur mühsam meine Erregung zu unterdrücken. "Eine mögliche Massenauswanderung der Juden aus Deutschland, die von den Naziführern bewilligt worden war, war euch Zionisten eben nicht recht. Euch war lieber, daß die Juden zugrunde gehen. Chaim Weizmann sagte es ja übergenau."
Ehe der Doktor etwas erwidern konnte, pochte es von neuem, und Isaak stand bittend unter der Tür. "Jetzt", bat er, "ist es so weit."
Schwerfällig erhob sich Dr. Katz. Er sah mich forschend an, und sein Gesicht war mit einemmal verfallen. "Ich komme", sagte er kurz, nickte uns wortlos zu und verließ mit dem aufgeregten Vater unser Quartier.
"Ruth, meine einzige Schwester, ist in Deutschland", flüsterte Salomon. "Das alles kann nicht wahr sein", schrie er plötzlich, "das darf nicht wahr sein! Vielleicht ist vieles nur politisches Geschwätz, vielleicht sind das nur Gerüchte, wie so viele entstanden sind, oder bestenfalls Zeitungsgeschmier."
"Glücklich könnte man sein, wäre das so", entgegnete ich bekümmert. "Doch die Nachrichten, die wir bekommen haben, sind genau, zu genau, als daß sie bezweifelt werden könnten. Mitte 1938 fand in Evian eine Staatenkonferenz unserer Leute statt, zu der Präsident Roosevelt aufgerufen hatte. Sie wurde unter dem Namen Eviankonferenz bekannt. Man diskutierte dort des langen und breiten darüber, wie die jüdische Auswanderung aus Deutschland am besten organisieren könnte."
"Der amerikanische Präsident", strahlte der Junge. "Und warum geschah dann nichts? Hat Hitler dennoch am Ende sein Einverständnis verweigert? Das habe ich mir gleich gedacht, daß die Nazis gar nicht wollten."
Bedrückt schüttelte ich den Kopf. "Es fanden sich keine Länder, die die deutschen Juden aufnehmen wollten, und es fanden sich auch keine nennenswerten Kapitalien, die die Auswanderung fördern konnten. Man kann viel gegen die Deutschen vorbringen, für uns Juden sind sie eine wahre Gottesgeißel geworden. Doch, sie haben die Auswanderungspläne des Leiters des Judenreferats im deutschen Auswärtigen Amt vor 1933 – es war der Jude Sobelheim – hinsichtlich der Auswanderung nur fortgesetzt.
In Österreich wurden eigene Umschulungslager für jüdische Siedler in Palästina geschaffen. Sie befanden sich in Waidhofen an der Ybbs und in Altenfelden in Oberösterreich"
"Das ist alles kaum zu glauben", jammerte der Junge, "wie ging das nun weiter?"
Gescheiterte Auswanderungspläne
"Die Nachrichten von Evian und der erfolglosen Konferenz hatten vor allem auf den damaligen Chef des Vierjahresplanes, Hermann Göring, einen großen Eindruck gemacht. Am 21. Januar 1939 schrieb er an Ribbentrop, daß der Juden aus Deutschland mit allen Mitteln zu fördern und eine Reichszentrale für die jüdische Auswanderung zu bilden sei. Wenige Tage später, schon am 28. des gleichen Monats, gehorchte das Auswärtige Amt in Berlin der Weisung des allmächtigen Göring und schrieb an alle deutschen Konsulate und diplomatischen Vertretungen im Ausland, man möge erkunden, welche Einwanderungsmöglichkeiten in den einzelnen Ländern bestünden, da das Anwachsen der Juden im Großdeutschen Reich ein Problem bedeute. Zu den 500 000 deutschen Juden waren über 200 000 österreichische dazugekommen Daher sei die Judenauswanderung zu beschleunigen. Angeblich dachte man – wenigstens steht es so in diesem Schreiben – nicht an eine Konfiskation des jüdischen Vermögens, sondern an eine Reichsschuldverschreibung. Jeder Auswanderer sollte einen solchen Reichsschuldschein bekommen, damit das Deutsche Reich später die Schulden abzahlen müßte."
"Und was war das mit dem Madagaskar-Plan, den Sie vorher erwähnten?"
"Legationsrat Rademacher, der 1939 das Referat für jüdische Auswanderung übernahm, trug Hitler persönlich vor, daß die Unterstützung der Zionisten die traditionellen deutsch-arabischen Beziehungen gefährde. Er schlug zur Auswanderung Madagaskar vor, und schon am 15. August 1940 wurde der Madagaskar-Plan schriftlich fixiert. Einen Monat zuvor, am 12. Juli 1940, wurde ein detaillierter Plan für die jüdische Auswanderung von der Deutschen Reichsregierung protokolliert."
Der Junge schlug die Hände vor das Gesicht. "Oh Gott, oh Gott", klagte er, "wie wird das alles noch enden?"
"Schlecht", sagte ich niedergeschlagen. "Wie sollte es auch anders enden?"
"Als ich das erste Mal von dem Dampfer 'Struma' hörte", erzählte Salomon, "habe ich es auch nicht geglaubt. Später mußte ich es wohl, denn von unseren Freunden aus Bukarest war einer dabei. Seine Eltern haben es mir ja vergangene Woche geschrieben."
"Struma‘?" fragte ich interessiert. "Davon habe ich noch gar nichts gehört."
"Die rumänische Regierung", berichtete der Junge monoton, "erlaubte im Dezember 1942 eine Auswanderung von Juden mit dem Hundertachtzig-Tonnen-Dampfer 'Struma', der die Emigranten in Constanza an Bord nahm. Es waren genau 768 Juden, unter ihnen 70 Kinder. Sehr bald erreichten sie die Küste von Palästina und waren glücklich, all das Grauen und die Furcht hinter sich gelassen zu haben. Doch die Briten ließen das Schiff nicht nach Haifa hinein. So blieb ihnen nichts anderes übrig, als zu wenden, und in seiner Verzweiflung warf der Kapitän im Bosporus Anker. Die Türken rollten immer wieder das jüdische Auswanderungsschiff los sein, aber unsere Leute waren verzweifelt; sie wußten ja nicht mehr ein und aus. Zurück nach Rumänien wollten sie nicht, und nach Palästina ließen sie die Engländer nicht. Nach zehn Wochen machten die Türken kurzen Prozeß. Sie fuhren mit Schleppern an die 'Struma' heran und brachten sie so mit Gewalt auf hohe See. Ein Schiff ohne Hoffnung und ohne Ziel. Wenig später lief es auf eine Treibmine. Die 'Struma' sank nur zwölf Kilometer von der türkischen Küste entfernt mit Mann und Maus. Alle ertranken, auch die Kinder.
Die Eltern meines Freundes schrieben mir, ein britischer Abgeordneter habe im Unterhaus die englische Regierung gefragt, warum man angesichts des jüdischen Schicksals nicht andere Methoden anwende, um den Juden zu helfen.
Außenminister Eden antwortete kühl. Er sagte unter anderem: 'Gewisse Sicherheitsmaßnahmen müssen erwogen werden', und verwies auf die großen geographischen Schwierigkeiten. Die Eltern meines Freundes haben das alles aus dem englischen Rundfunk gehört, dessen Nachrichten sie heimlich abhörten."
"Ein Beispiel mehr. Wir haben wieder erfahren, daß der Ministerpräsident Mihai Antonescu ebenfalls im Dezember 1942 hinter dem Rücken der Deutschen die Bukarester jüdische Zentrale verständigte, sie möge eine Liste von 75 000 Kindern zusammenstellen, denen die rumänische Regierung die Auswanderung erlauben würde. Doch es kam nicht dazu: Niemand war bereit, sie aufzunehmen."
"In was für einer Welt leben wir?" stammelte Salomon. "So stehen wir Juden hilflos zwischen den Henkern und den Heuchlern."
Ich stutzte. Dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen: Dieser Junge hatte wahrhaftig mit einem einzigen Satz die Situation umrissen, die ganze Tragik des jüdischen Schicksals umfaßt. Tatsächlich, wir waren dazu verdammt, ein Leben zwischen Henkern und Heuchlern zu führen!
"Du hast nur zu recht", pflichtete ich ihm bei. "Vergiß es nur nie, Samy, was die Wahrheit ist. Vielleicht wird einer von uns am Leben bleiben, der soll dann der Welt verkünden, wie es war. Und er soll ihr auch sagen, daß alles hätte anders kommen können. Schon wurden in Rüdnitz bei Berlin und in Schniebichen in Schlesien große Güter erworben, auf denen junge Juden in Lehrkursen für ihren künftigen landwirtschaftlichen Einsatz in Palästina geschult wurden. In Berlin selbst gab es eine Lehranstalt für jene jüdische Jugend, die sich lieber handwerklich auf ihr kommendes Leben vorbereiten wollte. Diese Juden wurden nach strengem Ausleseprinzip ausgewählt, denn nur die Besten sollten zuerst zum Einsatz kommen. Trotzdem gingen von diesen Lehrgütern und der Berliner Schule aus 5000 junge Juden nach Palästina. Sogar dann noch, als der Krieg ausgebrochen war. Natürlich alles mit Genehmigung und teilweise sogar Unterstützung der Reichsregierung."
Gerade als Salomon antworten wollte, stürzte Dr. Katz zur Tür herein.
"Was ist?" fragte meine Frau erschrocken. "Geht es der jungen Mutter nicht gut?"
Der alte Arzt machte eine wegwerfende Bewegung. "Ein junger Knabe, frisch und gesund. Mutter und Kind geht es gut. Doch habt ihr schon erfahren? In Stalingrad hat der Feldmarschall Paulus kapitulieren müssen. Das ist der Anfang vom Ende. Heute müßte man etwas zu trinken haben. Die Deutschen werden zusammenbrechen, und alle Schande und alle Not, die sie über uns gebracht haben, wird auf sie zurückfallen."
Wir schwiegen ergriffen. Schon die ganze Zeit hatten wir von den Rumänen erfahren, daß es sehr schlecht stand an der russischen Front, besonders bei Stalingrad. Nun hatte Hitler gerade diese Schlacht um Stalingrad zu einem symbolischen Ringen proklamiert, und sein Propagandaminister Goebbels hatte die weltanschauliche Deutung dieses Kampfes an der Wolga in lautesten Tönen in alle Welt hinausposaunt. Jetzt aber waren die Deutschen in diesem entscheidenden Ringen geschlagen worden. Beinahe konnte man es nicht glauben. Monat für Monat, ja Jahr um Jahr hatten wir alle die Nachrichten von den nicht enden wollenden Siegen vernommen. Jetzt endlich hatte das Schicksal Halt geboten.
Meine Frau hatte die Hände gefaltet: "Wenn es nur bald Frieden gibt", sagte sie leise, "wenn wir nur wieder nach Hause zurück können."
"Und wenn nur alle verfluchten Deutschen vernichtet würden", fügte Dr. Katz ihrem Wunsch hinzu. "Mit Mann und Maus, mit Weib und Kind sollen sie zugrunde gehen."
Mir lief es kalt über den Rücken. Mit einemmal war meine Freude, die ich noch eben empfunden hatte, wieder erloschen. Es würde auch dann keinen Frieden geben, wenn dieser Krieg vorüber war. Heute nicht und morgen nicht. Alles würde weiterlaufen: der Haß und der Terror. Ohne Ende, Der einzige Unterschied würde sein, daß einmal die einen oben und die anderen unten sein würden, und dann wieder umgekehrt. War das der Sinn des Lebens?
Für uns Juden in Transnistrien hatte dieser 2. Februar 1943, an dem der letzte deutsche Widerstand in Stalingrad zusammenbrach, eine erfreuliche Folge. Bald darauf kam der Schweizer Vertreter des Internationalen Roten Kreuzes, Kolb, mit Genehmigung der rumänischen Regierung nach Transnistrien. Dieser Besuch brachte verschiedene Erleichterungen, vor allem erhielten wir mehr Lebensmittel und Medikamente.
Wir verfolgten nun aufmerksam und mit Spannung den Ablauf des Kriegsgeschehens, der sich immer dramatischer gestaltete. Jetzt merkten auch die Pessimistischsten und die Ungläubigsten, daß sich das Schicksal gewendet hatte. Trotz alledem fürchteten wir, daß der Krieg nun mit seiner ganzen brutalen Härte auch wieder über Transnistrien rollen würde. Diesmal war es nicht zu erwarten, daß die Kampfhandlungen unseren Raum aussparen würden. Wir wagten nicht daran zu denken, was geschehen würde, wenn die geschlagenen rumänischen und deutschen Verbände uns Juden hier vorfinden würden. Die Rache war kaum auszumalen.
Dann sah es kurze Zeit so aus, als ob die Rote Armee doch nicht so schnell vorwärts rücken könnte. Die Deutschen schlugen sich mit dem Mut der Verzweiflung.
Das Warschauer Getto
Eines Morgens, es war am 19. April 1943, kam ich gerade von einer nicht sehr erfolgreichen Hamsterfahrt nach Hause, als mich dort schon ungeduldig die Nachbarn erwarteten.
"In Warschau kämpfen unsere Leute", rief mir der eine entgegen.
Salomon fragte ungeduldig: "Könnten wir ihrem Beispiel nicht folgen?"
Die Meinungen überschlugen sich. Endlich erfuhr ich auch, was geschehen war: Im Warschauer Getto tobte ein erbitterter Kampf. Über den englischen Sender hatten meine Freunde die ersten kümmerlichen Nachrichten aufgefangen. Es dauerte noch geraume Zeit, bis wir den vollen Umfang der Tragödie erfuhren.
Schon Ende 1940 begann man deutscherseits, in Warschau ein Getto zu errichten, in dem infolge des starken Zuzugs aus ganz Polen in die Landeshauptstadt etwa 500 000 Juden lebten. Die Deutschen kümmerten sich nicht allzuviel um das Getto, im Gegenteil, sie ließen den Juden sogar freie Hand. Im Getto gab es eine rein jüdische Verwaltung, selbstverständlich jüdische Polizei und auch eine Reihe Unternehmungen. Alles in allem war es ein Judenstaat im kleinen. Die deutsche Rüstungsindustrie hatte noch dazu die Zusammenballung dieser riesigen Menschenmassen raffiniert ausgenutzt und sogar einen Teil der Kriegsindustrie in das Warschauer Getto verlegt. Alles ging seinen zwar nicht erfreulichen, aber immerhin für jene Zeiten erträglichen Gang. Genauso wie bei uns in Transnistrien gab es Juden, die hungerten und verhungerten, und andere wieder, die am Handel und namentlich an den Industrien wahre Reichtümer erwarben.
Da trat weit weg von Warschau ein Ereignis ein, welches das Schicksal dieser 500 000 Warschauer Gettojuden auf das entsetzlichste entschied.
In der Tschechei hatten die Deutschen einen erstaunlichen Schachzug gemacht. Sie hatten den Chef des Reichssicherheitshauptamtes, den berüchtigten SS-General Reinhard Heydrich, als stellvertretenden Reichsprotektor von Böhmen und Mähren eingesetzt, und schon Monate später konnte der britische Geheimdienst erkennen, daß es Heydrich gelang, die arbeitsamen, aber auch wankelmütigen Tschechen immer mehr mit der Nazi-Herrschaft auszusöhnen. Die tschechische Landwirtschaft, jedoch auch die tschechische Industrie leisteten prozentual mehr in der Produktion als die deutsche Wirtschaft. Von einem Widerstandswillen der Tschechen gegen die Deutschen war gar nicht mehr zu reden.
Um nun diese Entwicklung zu verhindern, plante der britische Geheimdienst einen Anschlag auf den verhaßten Heydrich, und so sprangen schon in der Nacht des 29. Dezember 1941 zwei tschechische Saboteure, Jan Kubis und Josef Gabcik, bei Prag ab und bereiteten sich sorgsam auf das geplante Attentat vor.
Am 27. Mai 1942 warfen sie dann in den offenen Mercedes Heydrichs im Prager Vorort Holeschowitz eine Handgranate. Heydrich wurde so schwer verletzt, daß er acht Tage später starb.
Die SS-Führung tobte. Obwohl die beiden tschechischen Attentäter und ihre Verbündeten wenig später, und zwar am 17. Juni, von zwei Mitverschwörern gegen eine Belohnung von je 500 000 Reichsmark an die Gestapo verraten wurden und sich zum Schluß selbst den Tod gaben, entlud sich der Haß der SS-Führung gegen die Juden. Dabei war an dem ganzen Attentat gegen Heydrich nicht ein einziger Jude beteiligt! Im Juli 1942 gingen plötzlich in Warschau Gerüchte um, die von einer Liquidierung des Gettos berichteten.
Die verschiedenen jüdischen Organisationen, die politisch selbst imGetto keineswegs einer einheitlichen Auffassung waren, versuchten nun, angesichts dieser Gefahr zu einer einheitlichen Führung zu gelangen, und gründeten das antifaschistische Aktionskomitee des Gettos. Von den Zionisten übernahm der Linkssozialist Sagan und von den Kommunisten Lebartowski-Finkelstein die Führung des Komitees. Eine gemeinsame Gettozeitung "Der Ruf" wurde heraus gegeben und erschien illegal.
Schon während der Jahre zuvor wurde das Leben im Warschauer Getto ausschließlich von den Kommunisten und den Zionisten organisiert. Die stärkste jüdische Gruppe in Polen, die jüdisch-sozalistische Arbeiterpartei "Der Bund", die bei allen letzten Wahlen zur polnischen Kultusgemeinde die Mehrheit errungen hatte, war übergangen worden. Die Masse der "Bund"-Funktionäre hatte sich bei Kriegsausbruch nach der Sowjetunion geflüchtet, andere wieder über den Balkan nach England. So war nur die untere Führerschaft in Warschau geblieben, die von den Kommunisten und Zionisten an die Wand gedrückt worden war.
Das antifaschistische Aktionskomitee stellte zuerst einmal eine organisierte Kampfgruppe auf und gab ihr Terroraufgaben. Die Angehörigen des Judenrates und der jüdischen Polizei, die sehr eng mit dem SS-Oberkommando zusammenarbeiteten, wurden auf gefordert, weniger pflichtgetreu zu sein. Der Kommandant des jüdischen Ordnungsdienstes im Getto Jakob Leikin, wurde ermordet. Viele folgten. Bald beherrschte das Aktionskomitee das Getto.
Die Führung des Aktionskomitees nahm auch Verbindung mit dem christlich-polnischen Untergrund außerhalb des Gettos auf. Dabei spielten die Kommunisten die größte Rolle, da nur sie wirklich gute Verbindungen vom Getto in die Stadt hinaus hatten. Dazu fehlte ja den Zionisten jeder Kontakt mit christlichen Gruppen. Soweit es möglich war, begann sich die Kampfgruppe zu bewaffnen.
Eines Tages forderten SS-Funktionäre vom Präsidenten des Judenrates, dem getauften Juden Ingenieur Adam Czerniakow, 6000 Juden, die außerhalb des Gettos arbeiten sollten, Die 6000 wurden ausgewählt und marschierten aus dem Getto aus. Sie kamen nie mehr wieder. Kurze Zeit danach erfuhr man gerüchteweise, daß sie erschossen worden wären.
Die sogenannte Aktion Reinhard gegen das Warschauer Getto als Rache für den Tod Heydrichs hatte begonnen.
Als Czerniakow weitere 10 000 Juden für auswärtige Arbeiten stellen sollte, vergiftete sich dieser gewissenhafte Mann, um den Anordnungen nicht nachkommen zu müssen. Sein Nachfolger war nicht so charaktervoll, und so kam es, daß Transporte von je etwa 5000 Menschen immer aufs neue das Getto verlassen mußten.
Das Aktionskomitee sandte laufend Kuriere mit Lageberichten und nach Palästina und bat die kriegführenden Mächte um rasche Hilfe. Doch diese kam nicht. Wahrscheinlich wurden die Nachrichten aus dem Warschauer Getto im Westen und im Osten zu den Akten gelegt. In London bestand zu jener Zeit ein Exilparlament, in dem sämtliche polnische Parteien vertreten waren, und als Delegierter des polnischen "Bund" war Sch. Sieglbaum dort. Er galt auch als Verbindungsmann zwischen diesem Exilparlament und der britischen Regierung. Als er die Überzeugung gewann, daß die britische Regierung in keiner Weise gewillt war, wenigstens versuchsweise Hilfsmaßnahmen zu ergreifen, ging er aus Protest gegen diese Gleichgültigkeit in den Freitod. Doch auch dieses Opfer war vergeblich.
Nun versuchte das Komitee durch alte unterirdische Gänge, zum Teil durch die Kanalisation, täglich Gruppen bis zu fünfzig Personen aus dem Getto hinauszuschmuggeln, was tatsächlich auch gelang. Die Gettojuden wurden von den polnischen Partisanen herzlich aufgenommen und zum Teil nach der Slowakei oder Ungarn weitergeleitet.
Natürlich konnte dieser grandiose Menschenschmuggel dem SS-Oberkommando auf die Dauer nicht verborgen bleiben, und man verstärkte die Aussiedlung des Gettos, wie dies offiziell genannt wurde, mit aller Gewalt. Schon am 19. Oktober 1942 meldete der Distriktsgouverneur von Warschau an das Generalgouvernement in Krakau: "Die Umsiedlung im jüdischen Wohnbezirk in Warschau ist Ende September vorläufig abgeschlossen worden. Es sind etwa 35 000 Juden im jüdischen Wohnbezirk Warschau zurückgeblieben. Hierbei handelt es sich fast ausschließlich um Arbeiter der noch zurückgebliebenen Rüstungsbetriebe. Insgesamt sind etwa 400 000 Juden aus Warschau evakuiert worden."
Himmler war mit diesem Ergebnis unzufrieden und befahl am 16. Februar 1943 dem SS-Obergruppenführer Krüger, das Getto Warschau nach Verlagerung des KZs abzureißen, damit das Getto von der Bildfläche verschwinde. Am 18. April 1943 waren dann Polizei- und SS-Einheiten im Getto einmarschiert, um die restliche Bevölkerung herauszuholen. Die Deutschen wurden mit einem Kugelregen empfangen, erlitten schwerste Verluste und verließen fluchtartig das Getto. Nunmehr begann ein regelrechter Kampf. Das Aktionskomitee hatte für diesen Zeitpunkt Vorsorge getroffen und die kampfbereiten Juden bewaffnet. Teilweise kamen die Waffen aus den eigenen Rüstungsbetrieben, teilweise durch die Kanäle vom polnischen Untergrund, selbst die rechtsextremistischen polnischen Gruppen lieferten Gewehre, Handgranaten und Munition. Während des Kampfes wurden auch zahlreiche Waffen von den toten Deutschen erbeutet.
Der militärische Führer von Warschau war der junge Mordechai Anilewitsch, der seine Kampfgruppen fest in der Hand hatte. Die Deutschen griffen das Getto mit Bombenfliegern, Panzern und Artillerie an. Trotzdem wehrten sich die Juden verzweifelt.
Erst am 16. Mai 1943 konnte SS-Brigadeführer Stroop dem SS-Obergruppenführer Krüger melden, daß die letzten 180 Juden vernichtet worden wären. Im Schlußbericht über die Vernichtung des Gettos hieß es: "Das ehemalige jüdische Wohnviertel Warschaus besteht nicht mehr. Die Gesamtzahl der erfaßten oder nachweisbar vernichteten Juden beträgt 56 065."
Warum zuerst gemeldet wurde, daß nur etwa 35 000 Juden zurückblieben und später 56 065, konnte nie aufgeklärt werden. Mordechai Anilewitseh hatte das traurige Ende nicht mitzumachen brauchen. Er war eine Woche zuvor am 8. Mai im Kampf gefallen. Unter den Gefangenen des Warschauer Gettos befand sich auch der bekannte zionistische Dichter Kazenelson aus Lodz, für den sofort der Konsul aus Honduras in Genf intervenierte. Tatsächlich brachten die Deutschen Kazenelson in ihr Interniertenlager nach Vittel in Frankreich, wo etwa 300 Juden saßen, für die lateinamerikanische Staaten interveniert hatten‘ Ende 1944 allerdings wurden die Insassen des Lagers Vittel nach dem Osten verfrachtet, und viele verschwanden spurlos. Auch Kazenelson.
Doch es geschahen auch andere Dinge. Viele Jahre später veröffentlichte in Jerusalem Moses Prager ein Buch, in dem er eingehend schilderte, wie der Wunderrabbi von Ger aus dem Warschauer Getto mit 40 seiner Angehörigen ganz offiziell nach Palästina auswandern konnte. Das gab es auch.
Manche von uns dachten entsetzt, daß es uns wohl kaum anders gehen würde als unseren Glaubensbrüdern im Warschauer Getto. Nur daß wir nicht einmal Waffen hatten, keine Mauern und keine unterirdischen Gänge. Wir waren wehrlos allem ausgeliefert, was da kommen sollte.
 Вильгельм Телль
Вильгельм Телль























