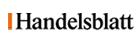|
|
WILLIAM TELL วิลเลี่ยม เทล  Вильгельм Телль Вильгельм Телль |
Finanzen/Wirtschaft
Das böse Wort von der Enteignung der Banken macht in Berlin die Runde. Strikt ökonomisch gesehen ist das ein Hirngespinst, denn enteignen lässt sich nur, was noch einen Wert hat. Der ist in der Finanzbranche aber schon längst flöten gegangen. Das gilt zuvorderst für die Hypo Real Estate, leider aber - Ausnahmen mag es geben - auch für große Teile des übrigen Bankensystems. Außer dem Staat will deshalb derzeit niemand mehr Kapital zur Verfügung stellen. Springt er über Kapitalerhöhungen ein, wird er automatisch zum maßgeblichen Aktionär. Ein Enteignungsgesetz ist nicht nötig, taugt auch nicht als parteipolitische Propaganda im Wahljahr.
Auch wenn es keiner gerne hört: Ohne den Staat, ohne den Bürger, sind die Banken zumindest nach heutiger Rechnungslegung pleite. Schon mit der Garantie der Spareinlagen durch Bundeskanzlerin Angela Merkel im Oktober wurde das Ausmaß der Misere deutlich. Wahrscheinlich konnte nur mit diesem beherzten Schritt das Horrorszenario eines "Bank-Runs" verhindert werden.
Damit nicht genug. Staat und Aufsicht mussten zu weiteren drastischen Maßnahmen greifen, um das Schlimmste zu verhindern: etwa der Lockerung der Bilanzierung nach Marktpreisen, die kurz zuvor (fast) allen noch als das allein Seligmachende galt. Sie setzten auch die Insolvenzordnung im Rahmen des Finanzmarktstabilisierungsgesetzes außer Kraft. Dank Artikel 5 gilt nun praktischerweise: Auch bei Überschuldung ist man keineswegs zwingend pleite.
Bei vielen Häusern ist das längst der Fall, wie eine einfache Rechnung zeigt. Laut Bundesbankstatistik summierten sich Eigenkapital und Rücklagen der deutschen Institute zuletzt auf etwa 450 Mrd. Euro. Denen stehen allein bei den großen Häusern toxische Wertpapiere von 300 Mrd. Euro gegenüber - auch das ein Befund ebenjener Bundesbank. Im Bundesfinanzministerium kursieren sogar Schätzungen, die mehr als das Dreifache veranschlagen.
Ohne den Staat geht es zumindest vorübergehend nicht. Umso wichtiger ist, dass der Bürger am Ende nicht auf der Zeche sitzenbleibt. Für die Übernahme von Risiken und eventuelle Verluste müssen Banken und Aktionäre zahlen. Zunächst gilt es, die Abwertungsspirale bei gesunden Papieren, den vielzitierten sicheren Staatsanleihen, zu durchbrechen. Staatliche Garantien - gegen Gebühr, versteht sich - sind nötig.
Die giftigen, wirklich ausfallgefährdeten Wertpapiere hingegen müssen schnellstens entsorgt werden. Bei einigen Instituten wird das zu mehr oder weniger massiven Verlusten, staatlichen Kapitalspritzen und in der Folge hohen Beteiligungen des Bundes führen.
Ordnungspolitisch mag das ein Dilemma sein, praktisch führt es aber zu Transparenz. Wirklich gesäuberte Bilanzen sorgen nicht nur dafür, dass die für die Wirtschaft so wichtige Kreditvergabe wieder in Schwung kommt. Sie machen die Banken auch attraktiv für Investoren und schaffen so die Voraussetzung für eine unumgängliche, rasche Reprivatisierung.
Alternativen sind theoretisch denkbar, doch führen sie zur Haftung durch den Bund ohne gebührenden Ausgleich. Der vorübergehende Übergang in Staatsbesitz sorgt wenigstens dafür, dass der Bürger auch Zugriff auf das Erholungspotenzial hat.
Anatomie einer Weltkrise, die gerade erst begonnen hat
So lauter der Titel der Zeitschrift „Der Spiegel“ vom 17.11.08. Auf 23 Seiten wird über dieses Thema berichtet.

GEORGE WASHINGTON who led the Continental Army to victory over the Kingdom of Great Britain in the American Revolutionary War or how GREAT BRITAIN IS KILLING "symbolically" GEORGE WASHINGTON who led the Continental Army to victory over the Kingdom of Great Britain in the American Revolutionary War (1775–1783).
Acht SPIEGEL-Redakteure und -Mitarbeiter haben in den vergangenen Wochen recherchiert, wie es zur größten Finanzkrise seit 1929 kommen konnte, einer Krise, die 23 Billionen Dollar Wertverlust an den Börsen der Welt brachte, die bislang 21 Banken allein in den USA in den Ruin trieb.
Seit Wochen versuchen die Regierungen der größten Wirtschaftsnationen, die Finanzmärkte und die Krise in den Griff zu bekommen, so auch am Wochenende in Washington. Den Weg in die Katastrophe zeichnet nun der SPIEGEL in seiner Titelgeschichte nach. In ihr wird deutlich, wie einfallsreiche, skrupellose Finanzjongleure jahrelang mit Milliarden zockten und die Risiken rund um den Globus versteckten.
Vor allem aber zeigen die Recherchen, dass in den Finanzmärkten Gefahren für die Weltwirtschaft lauern, die viel größeren Schaden anrichten können als die Immobilienkrise, die für die aktuellen Probleme verantwortlich ist. Eine 57-Billionen-Dollar-Blase, entstanden vor allem durch spekulative Kredit-versicherungen, droht, zu platzen und die Weltrezession dramatisch zu verschärfen.
SPIEGEL-Reporter Ullrich Fichtner besuchte in Zürich eine Messe der internationalen Großbanken, sprach mit Bankern aus mehreren Ländern und gewann den Eindruck: Die Banker, die die Welt an den Rand des Ruins getrieben haben, sind nun damit beschäftigt, wie sie zu Krisengewinnlern werden können. Fichtner ließ sich von einem Risikomanager der Credit Suisse in einem dreistündigen Hintergrundgespräch erklären, warum die Krise noch lange nicht vorbei ist und das Schlimmste noch bevorstehen könnte.
In Basel besuchte Fichtner die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, wo ihm Spezialisten die Zusammenhänge der Weltkrise darlegten. Mit vielen Finanzexperten diskutierte er die komplizierten innovativen "Finanzprodukte", die geholfen hatten, die Kreditblase aufzupumpen. Fichtner sammelte die Recherchen und Texte der Kollegen ein und verschraubte sie zu einem Wirtschaftskrimi, zur Chronik eines Kapital-Verbrechens.
"Die Lage ist schlimmer, als die Leute glauben"
Dass der US-Immobilienmarkt überhitzt war, hatte sich bereits im vergangenen Jahr abgezeichnet. Welche Gefahr darin lag, erfuhr Wirtschaftsredakteur Beat Balzli im Juli vergangenen Jahres, als im Berliner SPIEGEL-Büro Jamie Dimon, der Chef von JP Morgan Chase, zu Gast war. Auf die Frage, ob sich aus der Krise am US-Immobilienmarkt eine Rezession entwickeln könnte, antwortete Dimon unter anderem: "Die Lage ist schlimmer, als die Leute glauben."
Der Bericht im Spiegel schliesst mit diesen Sätzen:
Das aber heisst: Die unregulierten globalen Geldströme und die durch die Kreditspirale des vergangenen Jahrzehnts betriebene Geldvermehrung haben einen finanzmarktgetriebenen, nicht mehr auf Gütern und Waren und Handel gegründeten Kapitalismus etabliert, der ständig neue spekulative Blasen, erzeugen muss. Der Finanzmarkt ist der eigentliche Markt geworden, die klassische Wirtschaft ist es nicht mehr: Der Wert der Finanzanlagen übersteigt den Wert aller weltweit verkauften Waren und Dienstleistungen inzwischen um das Dreifache. Und dieser Überfluss an Kapital ist immer wieder die Quelle neuer Booms und Blasen, sie heissen New Economy, Subprimes oder „Emergings Markets“. Die nächste Blase, darauf wetten die Banker auf der Zürcher Messe schon jetzt, wird auf den Rohstoffmärkten erwartet.
Was können Staaten tun? Weltregierungen? Wenn die Blasen platzen, dann versucht die staatliche Notenbankpolitik das Abrutschen der Realwirtschaft in die Rezession stets durch Verbilligung von Krediten aufzuhalten, so war es 2001, so ist es in den USA auch heute: Der Leitzins ist auf ein Prozent gesenkt worden, wie es Mitte 2003 schon einmal der Fall war. Und wie so oft in einer Krise wehren sich Notenbanken und Regierungen mit immer neuer Geldzufuhr, immer neuen Staatsgarantien, immer neuen Milliarden, mit Billionen gegen das Platzen der finanziellen Superblase. Als wäre es eine letzte grosse Wette auf den Erhalt und gegen den Untergang der bestehenden Weltordnung.
Kann man von guten Zahlen leben? Versuchen kann man's jedenfalls, meinen Bundesregierung und Mainstream-Presse und präsentieren uns immer mehr Jubelzahlen: Der Aufschwung ist da, die Arbeitslosigkeit sinkt, daß einem schwindlig wird, und die Inflationsrate geht zurück.
Schließlich kann man ja auch von Placebos gesund werden. Oder die bittere Medizin wenigstens in reichlich Zucker verpacken.
Wie man das macht? Na, zum Beispiel so, wie die Nachrichtenagentur Reuters: »Inflation in Deutschland schwächt sich im April ab«, meldete sie am 15. Mai in einer dicken Headline. Um gleich darauf im ersten Satz zu behaupten: »Den deutschen Verbrauchern ist im April ein neuerlicher Teuerungsschub erspart geblieben.«
Toll. Aber wie das? Nun: »Die Verbraucherpreise stiegen um 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, bestätigte das Statistische Bundesamt am Donnerstag eine frühere Schätzung«, so Reuters. »Im März hatte die Teuerungsrate noch 3,1 Prozent betragen. Im Vergleich zum Vormonat gaben die Preise sogar um 0,2 Prozent nach.«
Nun gibt es ja eine goldene journalistische Regel: Das Wichtigste am Anfang. Um der lieben Propaganda Willen hat man diese Regel hier glatt auf den Kopf gestellt. Denn die eigentliche Nachricht wird ganz ans Ende des Artikels verschoben. Auch im nächsten Absatz darf der Leser nur erfahren, was alles billiger geworden ist: Urlaubsreisen zum Beispiel (um 7,4 Prozent).
Erst im 3. Absatz erfährt das verbliebene Häuflein Leser, was gegenüber dem Vorjahr alles teurer wurde (Ausnahme: Gemüse), nämlich
- Brot und Getreideprodukte um 8,8 Prozent,
- Molkereiprodukte wie Milch oder Butter um 24 Prozent,
- Benzin und Diesel um 5,8 beziehungsweise 17,2 Prozent.
Schlimm. Aber noch gar nichts gegen das, was man in der Reuters-Meldung überhaupt nicht findet: Die Teuerungsrate für ein so zentrales Produkt wie leichtes Heizöl zum Beispiel. Leichtes Heizöl ist so lebenswichtig wie Strom. Die Wahrheit ist: Leichtes Heizöl wurde gegenüber dem Vorjahr glatt um fast 40 Prozent (38,9) teurer.
Sagen Sie mal: Wäre DAS nicht die Schlagzeile gewesen! Nichts da. Denn da hätte es ja noch ganz andere Schlagzeilen gegeben, nämlich die Teuerungsraten für so zentrale Produkte wie
- Speisefette und -öle (+16,7 Prozent),
- Nudeln (+26,6 Prozent),
- Vollmilch (+31 Prozent),
- Quark (+47,2 Prozent).
Alles innerhalb eines Jahres, wohlgemerkt.
Womit der erste Satz des Reuters-Artikels widerlegt wäre: In Wirklichkeit ist uns ein »neuerlicher Teuerungsschub« keineswegs erspart geblieben. Vielmehr hat die Inflation in zentralen Bereichen nie dagewesene Werte erreicht. So rum wird ein Schuh draus, und das wäre die korrekte Nachricht gewesen.
Wie die Medien die in Wirklichkeit horrenden Teuerungsraten von bis zu 47 Prozent schön reden und schreiben, habe ich am Beispiel der Nachrichtenagentur »Reuters« im ersten Teil vom 19. Mai 2008 berichtet. Aber wie gehen die Bundesregierung und ihre Statistiker mit den teilweise enormen Teuerungsraten um? Ihre Antwort: Mit der Wahrnehmung der Bürger kann etwas nicht stimmen.
»Das Statistische Bundesamt hat Wissen und Zeit seiner Preisstatistikexperten investiert, um besser zu verstehen, wieso es zu Unterschieden zwischen subjektiver Inflationswahrnehmung und amtlich ermittelter Teuerung kommen kann.« Bewundernswert. Und die Antwort? Schuld ist natürlich der Verbraucher beziehungsweise seine »subjektive Wahrnehmung«. »Erstens werden Preissteigerungen höher bewertet als Preissenkungen. Zweitens schlägt es in der Wahrnehmung besonders zu Buche, wenn häufig gekaufte Produkte teurer werden. Und drittens vergleichen die Konsumenten die aktuellen Güterpreise nicht immer mit den Preisen von vor genau einem Jahr, sondern oft auch mit Preisen, die weiter als ein Jahr zurückliegen.«
Er ist halt ein bisserl schlicht, der Verbraucher, und nicht so genau wie die »amtlichen« Statistiker. In Wirklichkeit ist es genau umgekehrt. Der Durchschnitts-Teuerungswert (im Volksmund: »Inflationsrate«) der Statistiker besagt nur wenig über die realen Lebensbedingungen. In Wirklichkeit werden zum Teil horrende Preissteigerungen in einem »Warenkorb« mit 600 bis 700 Produkten und Dienstleistungen versteckt und eingestampft. Der Begriff »Warenkorb« suggeriert nur, hier handele es sich um jenen Einkaufskorb oder -wagen, den Sie täglich aus Tengelmann, Plus oder Aldi schleppen bzw. fahren.
Aber in Wirklichkeit handelt es sich dabei nur um Etikettenschwindel, denn der statistische und Ihr realer Warenkorb sind zwei ganz verschiedene Warenkörbe. Da können Preise für Grundnahrungsmittel innerhalb eines Jahres durchaus mal um 26,6 Prozent (Nudeln), 31 Prozent (Vollmilch) oder 47,2 Prozent (Quark) in die Höhe schnellen, verdünnt mit Hunderten von anderen Produkten und Dienstleistungen kann die Teuerungsrate – wie zuletzt im April 2008 – sogar sinken. Das heißt: Während Sie ihren Einkaufswagen mit, sagen wir, 30 Grundnahrungsmitteln zu Ihrem Kofferraum schieben und zu Hause die Strom- und Gasrechnung aus dem Briefkasten klauben, stopft Vater Staat einen ganzen LKW zusätzlich zum Beispiel mit Videorekordern, Fernsehern, Faxgeräten, Computern, Foto- und Filmausrüstungen, Reiseverträgen und Flugtickets voll und fragt: »Was haben Sie denn? Hier kann man doch echt billig einkaufen!«
Genau das ist der Unterschied zwischen statistischer und realer Teuerung. Dieses Verhältnis wird von der Regierung und den Medien dauernd auf den Kopf gestellt. Es wird nämlich so getan, als sei der statistische Wert der einzig wahre, der die reale »Inflation« (also Teuerungsrate) wiedergebe, während es sich bei dem, was der Verbraucher erlebt, nur um eine »gefühlte«, um nicht zu sagen: eingebildete Teuerung handele. In Wirklichkeit ist es genau umgekehrt: Die statistische Teuerungsrate ist ein absolut künstlicher Wert, der niemandem etwas bringt, so ähnlich wie die Durchschnittstemperatur auf dem Globus. Die ist verdammt angenehm, nämlich etwa 15 Grad, denn mitgerechnet werden bei der Durchschnittstemperatur auch Tropen und Wüsten. Würde ich diese Durchschnittstemperatur aber als Maßstab für meine Bekleidung nehmen, könnte ich sterben. Denn trotz 15 Grad globaler Durchschnittstemperatur würde ich mir am Nordpol oder im europäischen Winter den Allerwertesten abfrieren.
Zwar wird in dem amtlichen »Warenkorb« nicht jeder Posten gleich bewertet; vielmehr werden zentrale Produkte und Dienstleistungen höher »gewichtet«. Diese Gewichtung ist aber nur ein laues Zugeständnis an die Realität, damit sich die Statistik nicht gleich selbst ad absurdum führt. Erstens ist die Gewichtung nur ein mehr oder weniger unzureichendes Modell für die Wirklichkeit. Und zweitens sorgen steigende Preise für eine partielle Selbstregulierung der Teuerungsrate. Werden zum Beispiel lebenswichtige Produkte teurer, kann der Preis für weniger lebenswichtige wie Urlaubsreisen automatisch sinken. Ganz einfach, weil die Nachfrage zurückgeht. Zu behaupten, die Bürger würden bei steigenden Lebensmittelpreisen in anderen Bereichen dafür »entlastet«, ist glatte Augenwischerei, denn irgendwann können sich die Bürger die anderen Bereiche erst gar nicht mehr leisten. Denn »je teurer Energie, Milchprodukte, Nahrung etc. werden, desto weniger hat der Verbraucher für andere Ausgaben übrig«, so der Finanzexperte Michael Mross. "Manche Preise fallen zwangsläufig, weil der Konsument sie sich nicht mehr leisten kann." Ergebnis ist ein ausgeglichener(er) Teuerungswert. Eine gute Nachricht ist das vielleicht für die Bundesregierung, nicht aber für die Bürger.
Schauen wir uns mal den Verbraucherpreisindex für Deutschland genauer an. Da sanken im April 2008 die Preise zufällig genau in solchen Bereichen, in denen Viele sparen würden, wenn das Geld knapp wird. Zum Beispiel bei Freizeit und Unterhaltung sowie bei »Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen«, also zum Beispiel Ferienwohnungen und Pauschalreisen. Alles Sachen, auf die die Meisten notfalls verzichten können.
Mit anderen Worten: Während die Preisentwicklung asymmetrisch wird, bleibt die »Inflationsrate« gleich oder sinkt sogar. Während es sich bei der Statistik nur um einen Mittelwert handelt, der sich ständig auch noch selber reguliert und glättet, ist die reale Teuerung die, mit der der Verbraucher am Lebensnerv seiner täglichen Grundbedürfnisse getroffen wird. Würde man einen Warenkorb der Grundbedürfnisse zusammenstellen, würden die Energie- und Lebensmittelpreise die Teuerungsrate wahrscheinlich auf zehn bis 20 Prozent hochtreiben – wenn nicht mehr.

The perception that skyrocketing oil prices are due to oil shortage is reinforced by the Bush admin who is eager to deflect attention away from war and geopolitical turbulence.
The popular perception of the recently skyrocketing oil price is that there is an oil shortage in global energy markets. The perceived shortage is generally blamed on the Organization of Petroleum Exporting countries (OPEC) for “insufficient” production, or on countries like China and India for their increased demand for energy, or on both.
This perception is reinforced—indeed, largely shaped—by the Bush administration and its neoconservative handlers who are eager to deflect attention away from war and geopolitical turbulence as driving forces behind the skyrocketing energy prices.
Impressions of an oil shortage are further bolstered by Wall Street and its financial giants that are taking advantage of the insecurity created by war and geopolitical turmoil in oil markets and are making fortunes through manipulative speculation in commodity futures markets.
Perceptions of insufficient oil supply are also heightened by the recently resuscitated theory of the so-called Peak Oil, which maintains that world production of conventional oil will soon reach—if it has not already reached—a maximum, or peak, and decline thereafter, with grave socio-economic consequences.[1]
However, claims of an oil shortage are not supported by facts. Evidence shows that, in reality, there is no discrepancy between production and consumption of oil on a global level. Citing statistical evidence of parity between production and consumption of oil, OPEC President Chakib Khelil recently emphasized that there was no shortage of oil: "As far as fundamentals are concerned I think we have equilibrium between supply and demand. ... In fact right now we have more supply than demand."[2
Facts of abundant oil supplies in global markets are now also being acknowledged and reported by mainstream media. For example, Ed Wallace of Business Week recently reported that “that worldwide production of oil has risen 2.5% in the first quarter, while worldwide demand has grown by only 2%. Production is expected to increase by 3.3% in the second quarter, and by as much as 4.1% by the third quarter. The net result is that the U.S. daily buffer for oil production against demand, which was a paltry 1.5 million barrels as recently as 2005, is now up to 3 million barrels in excess capacity today.”
Wallace then asks, “So what is going on here? Why would our Energy Secretary say there's a supply and demand problem when none exists? Why would he say that speculators have little or nothing to do with the incredibly high price of oil and gasoline, when it's clear they do? President Bush—a former oilman—gives the ever-growing demand for gasoline as the primary reason prices are so high, yet that notion can be dispelled with one minute of research.”[3]
So, if indeed there is no imbalance between production and consumption of oil in global markets, how do we then explain the skyrocketing oil prices?
The answer, in a nutshell, is: war and geopolitical instability in oil markets. Contrary to the claims of the champions of war and militarism, of the Wall Street speculators in energy markets, and of the proponents of Peak Oil, the current oil price shocks are caused largely by the destabilizing wars and political turbulences in the Middle East. These include not only the raging wars in Iraq and Afghanistan, but also the danger of a looming war against Iran that would threaten the flow of oil out of Persian Gulf through the Strait of Hormuz.
Close scrutiny of the soaring oil prices shows that anytime there is a renewed U.S. or Israeli military threat against Iran, fuel prices move up several notches. For example, Agence France-Press (AFP) recently reported, “Crude oil prices went on a record-setting surge Friday as fears of a new Middle East conflict were fanned by comments from a top Israeli official about Iran. New York's main oil futures contract…leapt 10.75 dollars a barrel—its biggest one-day jump ever.”[4]
War and political chaos in the Middle East tend to increase energy prices in a number of ways. For one thing, as war plunges the U.S. deep into debt, it depreciates the dollar—thereby appreciating, or inflating, the price of dollar-denominated commodities, especially oil.
Depreciated dollar tends to raise the price of oil (and other commodities) in two major ways. First, since oil is priced in U.S. dollars, oil exporting countries would demand more of the cheaper dollars for the same barrel of oil in order to maintain the purchasing power of their oil. Second, when the dollar falls, oil prices rise because investors are more likely to use their money to buy tangible assets or commodities such as oil and gold that won't lose value.
According to a number of energy experts, between 30- and 40-percent of the recent increases in the price of oil can be attributed to dollar depreciation. One of the simplest ways to calculate this is to compare the price per barrel of oil in dollars and euros over the last five years. “The widening gap between the two [dollar price vs. euro price] indicates that 35 percent of the increase in the price of oil could be attributed to currency [dollar] devaluation.”[5]
Stronger than the impact of dollar depreciation on the price of oil has been the impact of manipulative speculation: war and political instability have served as breeding grounds for hoarding and speculation in energy futures markets.
According to F. William Engdahl, a top expert on energy and financial markets, “As much as 60% of today’s crude oil price is pure speculation driven by large trader banks and hedge funds. It has nothing to do with the convenient myths of Peak Oil. It has to do with control of oil and its price. ... Since the advent of oil futures trading and the two major London and New York oil futures contracts, control of oil prices has left OPEC and gone to Wall Street. It is a classic case of the tail that wags the dog.”[6]
U.S. Representative Bart T. Stupak, Democrat – Michigan, chairman of the subcommittee investigating commodity market speculation, attributes even a higher percentage of the oil price hike to market manipulation: “Speculations now account for about 70% of all benchmark crude trading on the New York Mercantile Exchange, up from 37% in 200.”
Wall Street financial giants that created the Third World debt crisis in the late 1970s and early 1980s, the tech bubble in the 1990s, and the housing bubble in the 2000s are now hard at work creating the oil bubble. By purchasing large numbers of futures contracts, and thereby pushing up futures prices to even higher levels than current prices, speculators have provided a financial incentive for giant futures traders to buy even more oil and place it in storage.
Unrestrained by an appalling lack of regulation, this has led to a steady rise in crude oil inventories over the last two years, “resulting in U.S. crude oil inventories that are now higher than at any time in the previous eight years. The large influx of speculative investment into oil futures has led to a situation where we have both high supplies of crude oil and high crude oil prices. . . . In fact, during this period global supplies have exceeded demand, according to the US Department of Energy.”[7]
The fact that the skyrocketing oil prices of late have been accompanied by a surplus in global oil markets was also brought to the attention of President George W. Bush by Saudi officials when he asked them during a recent trip to the kingdom to increase production in order to stem the rising prices. Saudi officials reminded the President that “there is plenty of oil on the market. Iran has put some 30 million barrels of oil that it can't sell into floating storage. ‘If we produced more oil, it wouldn't find buyers,’ says the Saudi source. It wouldn't affect the price at all."[8]
And why producing more oil “wouldn’t affect the price at all”? Well, because what is driving the soaring oil prices is not shortage but speculation: “with so much investment money sloshing around in the commodities markets, the Saudis calculate they have no hope of controlling short-term price fluctuations. They blame the recent price run-ups on speculation and fear of shortages [not real shortages], factors they say are beyond their control.”[9]
To sum up, manipulative speculation and dollar depreciation account for most of the recent increases in the price of oil—speculation accounts for nearly 60 percent, dollar depreciation for almost 40 percent. This is no longer a secret. What remains largely a secret, and needs to be exposed, however, is the relationship between speculation and dollar depreciation, on the one hand, and war and geopolitical instability, on the other.
While it is important to point out the impacts of dollar depreciation and commodity speculation on the price of oil, it is even more important to show that both of these factors are byproducts of war and militarism. Not only has the war played a critical role in the weakening of the dollar (through plunging the U.S. deep into debt), it has also created favorable grounds for manipulative speculation in commodity markets, especially energy markets.
Therefore, while efforts to curb speculation in energy markets (through regulation of the largely unregulated futures markets) or buttress the dollar from further declining may sound comforting, such efforts will remain illusive and ineffectual unless the devastating wars and military adventures in the oil-rich Middle East are terminated; that is, unless the root causes of currency depreciation and commodity speculation are exposed and cut out.
-- Ismael Hossein-zadeh, author of the recently published The Political Economy of US Militarism (Palgrave-Macmillan 2007), teaches economics at Drake University, Des Moines, Iowa.
References:
[2] “No oil shortage in markets,” Reuters (24 June 2008),
[3] Ed Wallace, “There Is No Gas Shortage,” Business Week (1 April 2008),
[4] “Oil Surges to New Heights after Israeli Warning on Iran,” Agence France-Press (6 June 2008),
[5]“Record oil prices tied to dollar depreciation,” GeoTimes.org (15 April 2008),
[7] Ibid.
[9] Ibid.
Source: Middle East Online